Die Initiative „Aufstehen“ ist mit einem hohen Anspruch gegründet worden. Sie soll dazu beitragen, der Einschätzung der InitiatorInnen nach vorhandene gesellschaftliche Mehrheiten für einen grundlegenden Politikwechsel zur Wiederherstellung des Sozialstaates in politische Mehrheiten für eine Ablösung der GroKo durch eine linke Regierung zu verwandeln.
Sie will den gesellschaftlichen Rechtsruck stoppen und verhindern, dass die „Rechte die kulturelle Hegemonie“übernimmt (Sarah Wagenknecht). Die Sammlungsbewegung soll „die Wanderung zur AfD stoppen und vielleicht umkehren“. (Oskar Lafontaine, dpa,3.9), indem sie Menschen gewinnt, die zur AfD tendieren, aber nicht rassistisch seien.
Das sind alles richtige Ziele. Die Diskussion um „Aufstehen“ ist dabei oft durch den Wunsch nach schnellen Erfolgen und einer linker „Machtperspektive“ geprägt. Das ist verständlich angesichts des bedrohlichen Aufstieges der Rechten. Eine empfundene Dringlichkeit, die das Handeln motivieren kann. Um die hitzige Diskussion um „Aufstehen“zu versachlichen, sollte sich die gesellschaftliche Linke dringend weiter über die sehr unterschiedlichen Einschätzungen sich verändernder Kräfteverhältnisse– die sozialen Umbrüche und die im Parteiensystem – verständigen.
1. Starker Start und schnelle Stagnation?
Noch bevor der Gründungsaufruf von „Aufstehen“ das Licht der Öffentlichkeit erblickte, hatten sich laut Angabe der Initiative bereits rund 100.000 UnterstützerInnen gemeldet.Die Zahl ist umstritten, da viele Personen, die als UnterstützerInnen geführt werden, lediglich den Newsletter abonniert haben, ohne die Programmatik zu teilen. Heute spricht die Initiative von rund 170.000 UnterstützerInnen. Doch diese Zahl muss stark relativiert werden: Von etwa 40.000 Personen verfügt die Initiative über vollständige Kontaktdaten. Zwar setzt die Initiative nach eigenen Ankündigungen stark auf Diskussionen, Mobilisierung und demokratische Entscheidungen im digitalen Raum. Doch bislang gab es nur eine Diskussion auf der eigenen Plattform polis, an der laut Eigenangaben circa 30.000 NutzerInnen teilnahmen. In den Facebook-Gruppen sind knapp 19.000 Personen registriert. Die wirkliche und weite gefasste UnterstützerInnenbasis von Aufstehen, die jedoch bislang keinerlei Entscheidungsbefugnisse hat, bewegt sich daher zahlenmäßig zwischen 19.000 und 40.000 Menschen. Insgesamt konnten laut Eigenangabe bislang etwa 5 bis 7% der UnterzeichnerInnen über Gruppentreffen und Veranstaltungen erreicht werden – der im weiten Sinne aktive Teil von Aufstehen umfasst also weniger als 10.000 Menschen.
Seit Oktober stagnieren die UnterstützerInnenzahlen. Das mediale Interesse lässt deutlich nach. In den social-media Foren wird bereits über die Gründe für die sich abzeichnende stagnierende Resonanz diskutiert. Gestritten wird über Sarah Wagenknechts Absage an die mit 250.000 Teilnehmenden sehr erfolgreiche Bündnisdemonstration „unteilbar“, über die Ursachen und Folgen des aktuellen Hypes der Grünen, über die Haltung von Aufstehen in der Migrationsfrage und das Verhältnis zu UnterstützerInnen der AfD, über mangelnde Einbeziehung der Basis in politische Entscheidungen und organisatorische Defizite. Ein Grund für die geringe Dynamik ist die zentralisierte und bisher noch weitgehend undemokratische Organisationsstruktur. Es handelt sich weniger um eine basis-demokratische Bewegung als um eine von oben organisierte, plebiszitäre Struktur. Nur bisher haben die social-media-Befragungen und Diskussionen kaum Einfluss und keine bindende Entscheidungsbefugnisse. Die Initiative „Aufstehen“ wird bislang von einem sehr kleiner Kreis von EntscheidungsträgerInnen geführt:Beratungen finden in einem nicht gewählten Arbeitsausschuss statt, der 22 Personen umfasst – neben Wagenknecht und Lafontaine einige, aber nicht alle Erstaufrufenden wie Fabio de Masi, Ludger Vollmer, Sevim Dagdelen, Marco Bülow und Simone Lange (SPD), intellektuelle Vordenker wie Bernd Stegemann und Andreas Nölke.
Anfang November startete die erste Kampagne unter dem Motto „Würde statt Waffen“. Dazu fanden am 3. November in rund einem Dutzend Städte Kundgebungen und Demonstrationen mit insgesamt rund 2.000 TeilnehmerInnen statt. An der ersten zentralen Kundgebung der Initiative mit ihren prominentesten Gesichtern, u.a. Sahra Wagenknecht, Marco Bülow und Ludger Volmer, am 9. November 2018 in Berlin nahmen lediglich einige hundert Menschen teil. Es wird schon jetzt deutlich: Die bisherige Resonanz ist auch für viele der UnterstützerInnen der Initiative eher eine Enttäuschung. So schreibt der Aufstehen-Unterstützer Rainer Balcerowiak: „Eine– relativ spärlich besuchte – Kundgebung am Freitag vor dem Brandenburger Tor,an der die geballte ›Aufstehen‹-Prominenz teilnahm,diente wohl in erster Linie der Selbstvergewisserung und Identitätsstiftung der eigenen Basis. Ein Alleinstellungsmerkmal, das den Aufbau einer Bewegung auch in der breiten Öffentlichkeit erkennbar machen würde, ist derzeit nicht zuerkennen. Denn Bekenntnisse für Abrüstung und Frieden, mehr soziale Gerechtigkeit, mehr Demokratie und ›gegen Rechts‹ findet man auch bei bestehenden Parteien, Verbänden und gesellschaftlichen Initiativen. Dem angestrebten Ziel, mit klaren Aussagen für eine neue, sozialstaatsorientierte Politik auf Basis und Anhängerschaft der existierenden Parteien des ›linken Lagers‹ einzuwirken, ist man kaum näher gekommen. Weder bei der SPD noch beiden Grünen scheint man „Aufstehen“ sonderlich ernst zunehmen.“ (ND 11.11;https://www.neues-deutschland.de/artikel/1105392.aufstehen-jetzt-fehlt-die-zuendende-idee.html)
Relevanter ist der Aufbau von lokalen Basisstrukturen. Dieser verläuft relativ erfolgreich. In etwa 100 Kommunen oder Landkreisen haben sich lokale Gruppen gebildet und mindestens einmal getroffen. Es bilden sich Strukturen auf Kreis und Landesebene, häufig analog zu den Strukturen der LINKEN. Manche dieser Treffen waren, vor allem in urbanen Räumen, hinsichtlich Teilnehmerzahl und Medienecho vergleichsweise gut, etwa in Berlin und Hamburg. Andere Treffen waren weniger erfolgreich, und an vielen Orten scheiterten bislang Bemühungen um Gründungstreffen. Auffällig ist, dass die lokalen Strukturen offenbar dort besser funktionieren, wo Bundestagsabgeordnete der Fraktion DIE LINKE mit ihren Beschäftigten und Ressourcen beteiligt sind, so in Berlin, Bochum, Hamburg, oder Promis wie Simone Lange eine Rolle spielen.
Diese Entwicklung verdeutlicht nicht nur, dass Sarah Wagenknecht als Fraktionsvorsitzende der LINKEN und Initiatorin von Aufstehen mit einem Ziel-und Rollenkonflikt umgehen muss, sondern wirft die Frage nach dem politischen Projekt von „Aufstehen“ erneut auf.
2. Keine Sammlungsbewegung des linken Mosaiks
Von Anfang an verbinden sich mit „Aufstehen“ sehr unterschiedliche Erwartungen. Bei Vielen, die „Aufstehen“ unterstützend, offen oder zumindest abwartend gegenüberstehen, ist es die Erwartung, die Diskussion um ein linkes Reformprojekt aus der Zivilgesellschaft heraus neu zu beleben.
Die Initiative zielt angesichts der Krise der Sozialdemokratie,dem Mitte-Kurs der Grünen und den Grenzen bisheriger „cross-over“-Initiativen für eine R2G-Regierungsoption scheinbar auf die Hegemoniefrage, die der Regierungsfrage vorgelagert ist. Der Anspruch durch eine linke Sammlungsbewegung mit Präsenz auf der Straße und in sozialen Medien, das gesellschaftliche Klima zu verändern, Druck auf SPD und Grüne aufzubauen, ist richtig. Aber von Anfang an blieb unklar, wie dieses Ziel erreicht werden soll. Insbesondere haben die InitiatorInnen von „Aufstehen“ offen gelassen, wie genau die „Übersetzung“ von medialer Präsenz und zivilgesellschaftlichem Protest in das vermachtete Feld der politischen Repräsentation aussehen soll. Dafür gibt es nur eine begrenzte Anzahl an Optionen:
- Eine wirkliche soziale Massenbewegung,die so stark ist, dass sie SPD und Grüne zu einem deutlichen Linkskurs zwingt. Diese müsste inhaltlich breiter aufgestellt und zugleich stärker sein als die TTIP-Proteste, die die SPD und die Bundesregierung in die Defensive brachten.Die bisherige Resonanz deutet gerade angesichts des abflauendem Medieninteresses und der fehlenden Verankerung in bestehenden Bewegungen (wie denen gegen rechts, für Solidarität mit Geflüchteten, für Klimaschutz oder die seit Monaten an vielen Orten dezentral stärker werdenden MieterInnen-Protesten) nicht auf eine Dynamik zu einer starken gesellschaftlichen Massenbewegung hin,die SPD und Grüne grundlegend verändern könnte. Um in wichtigen gesellschaftlichen Richtungskämpfen tatsächliche Erfolge gegen den Widerstand mächtiger Kapitalinteressen zu erreichen sind – das zeigt das Beispiele TTIP – ein langer Atem und wiederholte Mobilisierungen von mehreren Zehntausend Menschen und Höhepunkte deutlich über 200.000 Menschen notwendig. Eine solche Bewegung lässt sich in Zeiten relativer wirtschaftlicher Stabilität nicht zentralisiert und am Reißbrett und nicht alleine über den sehr weit gefassten Schwerpunkt „soziale Gerechtigkeit“ einfach aufbauen.
- Eine Art linke „Tea“-Party, die versucht von „innen“ und „außen“, durch Gründung von Strömungen, auch durch Mobilisierungen für Mitgliedereintritte, SPD oder LINKE zu verändern, gegebenenfalls sogar eine Fusion anzustreben. Eine solche Strategie wäre jedoch nur dann ein Erfolgsmodell, wenn eine der betreffenden Parteien mit der von „Aufstehen“ vorgeschlagenen politischen Ausrichtung auf Wiederherstellung des Sozialstaates in die Nähe der Union kommen und zugleich die Grünen unter Zugzwang geraten würden.
- Gründung einer neuen, sozialdemokratischen Partei. Dies wäre nur dann ein Erfolgsprojekt, wenn sie WählerInnen der SPD und der Grünen, zugleich aber auch massenhaft AnhängerInnen von AfD, CDU und FDP sowie NichtwählerInnen gewinnen könnte. Sonst handelte es sich lediglich um eine Verschiebung innerhalb des Spektrums links der Union.
Dass diese Optionen kaum öffentlich zur Diskussion gestellt werden und offene Fragen durch die Zuspitzung an Konfliktpunkten mit der LINKEN (insbesondere der Solidarität mit Geflüchteten und Migrationspolitik) sowie durch Wiederholung der vagen Formel einer „linken Mehrheit“ in den Hintergrund treten, ist kein Zufall, sondern Diskurstaktik. Denn trotz vieler Diskussionen um die inhaltliche Ausrichtung in der UnterstützerInnenschaft und im Arbeitsausschuss, soll ein zentraler Widerspruch derzeit absichtlich ungelöst bleiben: Wo die einen eine Chance zur Stärkung ihrer Parteien sehen, haben andere wie der Aufstehen-Mitgründer und ein intellektueller Kopf der Initiative, Andreas Nölke, eine „links-kommunitaristische Lücke“ im Parteienspektrum ausgemacht.
Derzeit sammelt sich ein heterogenes Spektrum: Enttäuschte, meist ältere AnhängerInnen der LINKEN und Nicht-Parteigebundene machen den größten Anteil aus, die Ausstrahlung auf AnhängerInnen der SPD, der Grünen und der AfD ist geringer.Die Gründung von Aufstehen aus der Partei Die LINKE heraus ohne vorherigen Diskussionsprozess und demokratische Beteiligung gibt Stoff für zum Teil scharfe Kontroversen. Weder der Parteiapparat und die Mitgliederbasis der SPD, die regelmäßig links blinkt, noch die Grünen im Umfragehoch lassen sich bisher von Aufstehen ernsthaft beeindrucken oder verunsichern.
„Aufstehen“ wirkt offensichtlich nicht als Projekt zur Zusammenführung der Kräfte links von der Mitte in Deutschland. Das wesentliche breitere politische Spektrum in der Zivilgesellschaft, dass sich eine sozial-ökologische linken Reformregierung wünscht, wird durch die Veröffentlichungen und Äußerungen von Wagenknecht und Lafontaine, Stegemann, Streeck, Nölke und Flassbeck, die immer wieder Willkommenskultur, Antirassismus und Feminismus sowie „Linksliberalismus“ zum Gegenstand z.T. polemisch zugespitzter Kritik machen, zum Teil abgeschreckt, ganz sicher aber polarisiert und nicht zusammengeführt. Schon jetzt droht „Aufstehen“ Gräben in der „Mosaik-Linken“(Urban) zu vertiefen und so das Gegenteil von dem zu bewirken, was sich kritische Unterstützer wie Michael Brie und Dieter Klein erhofften.
Die Initiative „unteilbar“ hingegen, die sich anders als Wagenknecht, Stegemann und Co. explizit anti-rassistisch positioniert, deutlich machte, dass Solidarität mit Geflüchteten und das Engagement für soziale Reformen im Interesse der Mehrheit der Bevölkerung untrennbar zusammengehören, konnte ein breites zivilgesellschaftliches Spektrum mobilisieren. Hier wurden das Potential und der Sinn einer wirklichen Sammlungsbewegung deutlich. Eine große Herausforderung für die „Mosaik“-Linke liegt darin, Ideen zu entwickeln, wieder Impuls von „unteilbar“ in unterschiedlichen Formen weiter entfaltet werden kann. Es existieren zahlreiche dezentrale soziale Initiativen (etwa in Mietenprotesten und antirassistischer Solidaritätsarbeit), Aktionen gegen Rechts und Rassismus, für entschlossenen Klimaschutz konnten im Herbst zusammengenommen Hunderttausende mobilisieren. Aber es fehlt eine politische Verbindung und Verdichtung. Notwendig ist eine breite gesellschaftliche Solidaritätsbewegung, die einen bunten und entschlossenen Pol für solidarische und sozial-ökologische Alternativen zu Neoliberalismus wie Rechtspopulismus sichtbar macht. Hier hat auch die LINKE eine wichtige Aufgabe. Anders als „Aufstehen“hat sie „unteilbar“ massiv unterstützt, mit-organisiert und ist vor Ort wie bundesweit in vielen Bündnissen sozialer Bewegungen organisch verankert.
3. Das kommunitaristisch-sozialdemokratische Projekt im Umfeld von „Aufstehen“

Anders als manchmal in überhitzten Diskussionen angeführt, ist „Aufstehen“ kein rechtes der „Querfront“-Projekt. Die Initiative ist vielmehr als Ausdruck von Suchprozessen in der tiefen Krise der Sozialdemokratie zu verstehen. Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine kooperieren eng mit einem sozialdemokratischen intellektuellen Umfeld (Bernd Stegemann, Andreas Nölke, Wolfgang Streeck, Heinar Flassbeck, Martin Höppner, Nils Heisterhagen u.a.). Dieses will über einen gemeinsamen politischen Diskurs eine Selbst-Kritik und grundlegenden Neu-Orientierung im Feld der Sozialdemokratie und sozial-liberaler Positionen bewirken. Sie wissen dabei, dass eine solche nicht aus den Parteiapparaten der SPD kommen, sondern nur durch eine politische Kraft vorangetrieben werden kann.Das Ziel ist es, in der Krise des Neoliberalismus ein neues politisches Projekt zu entwickeln, dass an die Sozialdemokratie vor der Wende zur „neuen Mitte“ anknüpft und diese auf einer neuen, „kommunitaristischen“ Grundlage mit sozial-orientierten Kräften und Strömungen des Liberalismus und Konservatismus verbinden soll. Das von Andreas Nölke u.a. skizzierte sozialdemokratisch-kommunitaristisch und nationalstaatlich-souveränistische Projekt weist enge Grenzen für eine Linke auf, die Hegemonie erringen und die Entwicklung zu einem autoritären Kapitalismus stoppen will.[1]
Nölke formuliert das bisher am klarsten umrissen Programm als „links-populäre“ oder links-kommunitaristische Politik (vgl. Andreas Nölke 2017[2]).Der Kern einer mehrheitsfähigen Linken sei ein realistisches und grundlegendes wirtschaftliches Reformprogramm zur Abkehr vom neoliberalen Exportmodell und der Einbindung in die neoliberale politische Ökonomie der EU. Viele richtige Forderungen decken sich mit den seit Jahren von links-keynesianischen Ökonomen formulierten Vorschlägen und wirtschaftspolitischen Konzepten der LINKEN.
Dazukommen Aspekte, die als eine Grundlage für einen auf nationalstaatlicher Souveränität fundierten „Klassenkompromiss“ (der so aber nicht als Bedingung für einen Erfolg dieser Wirtschaftspolitik benannt wird) gelesen werden können:Höhere Löhne sollen „freiwillige Arbeitszeitverkürzung ohne Lohnausgleich“ermöglichen und als „Produktivitätspeitsche“ (ebd.: 127) dienen, die Innovationen in den Betrieben anspornen. Öffentliche Beschäftigung und Förderung von Weiterqualifizierung sollen Vorrang vor der Öffnung der Arbeitsmärkte für ArbeitsmigrantInnen haben. Zielperspektive ist mehr nationalstaatliche Souveränität statt „Ausbau des supranationalen Eurostaates“(ebd.: 165). Erreicht werden soll das durch „selektiven Rückbau der sich radikalisierenden Supranationalisierung“ (ebd.: 166): Grenzüberschreitende Gütermärkte sollen gesichert werden (auch gegen eine drohenden radikalen Protektionismus von rechts), zugleich nationale Vetorechte gegen die Liberalisierung von „Dienstleistungen, grenzüberschreitenden Finanzströmen und Arbeitskräften“ geschaffen werden. Das Leitbild ist eine differenzierte europäische Integration kooperationswilliger Staaten auf freiwilliger Basis „im klaren Gegensatz zu Schäubles Modell eines von Deutschland dominierten Kerneuropas“. Der von Nölke geforderte „Respekt für eine Vielzahl wirtschaftlicher Modelle“ soll u.a. durch Rückkehr zum EWS-System koordinierter Wechselkurse und Verzicht auf die Förderung von Handelsabkommen erreicht werden. Doch diese politische Ökonomie ist alles andere als realistisch: Im Rahmen des Weltmarktes bleibt der Druck zur Steigerung der Wettbewerbsfähigkeit. Die Abwertung der Währung ist kein Ausweg aus der Standortkonkurrenz. Unklar bleibt, wie transnationale Wertschöpfung im nationalstaatlichen Rahmen und ohne massive Eingriffe in die Eigentumsverhältnisse sozial und ökologisch reguliert werden soll.
Das wirtschaftspolitische Wahlprogramm der LINKEN ist trotz notwendiger Weiterentwicklungen (z.B. zu Industriepolitik, Umgestaltung der privaten Dienstleistungssektoren,demokratischer, sozial-ökologischer Konversion) insgesamt deutlich weitreichender und zugleich realistischer als Nölkes Vorschläge. Auch La France Insoumise, die häufig als Vorbild für die Sammlungsbewegung dargestellt werden,setzen anders als Nölke, Flassbeck und Streck auf eine andere politische Ökonomie der Linken: 30-Stunden-Woche mit Lohnausgleich, radikale Vermögensbesteuerung für den ökologischen Umbau, Schritte zur Wirtschaftsdemokratie. Wirtschaftsdemokratie wird von Nölke als wenig realistische Utopie abgehandelt.
„Aufstehen“ soll auf der Grundlage eines sozialstaatlichen Kernprogramms breit anschlussfähig sein. Auch die LINKE stellt nicht in jeder Situation Maximalforderungen auf. Das ist nicht die Konfliktlinie. Den InitiatorInnen von „Aufstehen“ geht es um ein neues politisches Projekt in Abgrenzung zur LINKEN. Dabei spielt die den Diskurs von Nölke, Streeck, Flassbeck, Stegemann u.a. prägende Diskursstrategie eine zentrale Rolle, die LINKE als weltfremd darzustellen und das eigene Projekt als„vernünftig“ und „realistisch“. Streeck plädiert für die Politik einer „vernünftigen Linken“. Von der Partei DIE LINKE erwartet er wenig. Flassbeck schreibt: „Für eine Partei links von der SPD bedeutet das, dass sie einen Godesberg-Moment braucht, um wirklich etwas verändern zu können, also das explizite Eingeständnis, dass Systemüberwindung nicht zu ihrem Programm gehört. Nur wenn sie eine wirkliche und realitätsnahe Alternative bietet, kann sie für breite Schichten wählbar werden und eine reformunfähige und ohnehin am Abgrund taumelnde SPD endgültig aus dem Rennen werfen.“[3]
Die Diskurspolitik, die sich im intellektuellen Umfeld von „Aufstehen“ entwickelt hat, zeichnet sich durch verschiedene zentrale, immer wiederkehrende Elemente aus:
- Eine kommunitaristisch-sozialdemokratische oder „linkspopulistische“ Politik wird als einzige Chance dargestellt, eine weitere Rechtsentwicklung zu verhindern.Dadurch werden Dringlichkeit, Notwendigkeit und ein politischer Monopolanspruch kommuniziert.
- Das verbindet sich mit einer scharfen Gegnerschaft zum „Kosmopolitismus“ und „Linksliberalismus“, die den Neoliberalismus politisch-kulturell stützten oder mit diesem deckungsgleich seien. Die Gegnerschaft zu „Willkommenskultur“ und die Konstruktion eines „no-border-Neoliberalismus“ werden zu Signifikanten, die den Diskurs prägen. Sofern überhaupt eine Klassenperspektive in Anspruch genommen wird (wie bei Stegemann), wird Solidarität mit Geflüchteten nicht als Teil von linker Klassenorientierung, sondern als Sackgasse für diese dargestellt.
- Das dritte zentrale Merkmal ist die scharfe Abgrenzung nicht nur von SPD und Grünen, sondern auch von der LINKEN.Die LINKE habe dem Neoliberalismus nichts entgegen zu setzen: da sie a) zu unrealistisch und zu radikal (ein Argument, das von Nölke und Flassbeck stark gemacht wird), b) zu kosmopolitisch und c) zu sehr auf Minderheitenthemen statt auf die Verteidigung des Sozialstaates als Kernthema setze. Dabei wird auch mit falschen Unterstellungen gearbeitet, wie der Floskel, die LINKE habe die „soziale Frage“ als Kern ihrer Politik aufgegeben. Nölke unterstellt fälschlicherweise, dass sich Bernd Riexinger aus Rücksicht auf die Exportindustrie und kosmopolitischer Orientierung gegen grundlegende wirtschaftspolitische Alternativen zum neoliberalen Exportmodell ausspreche. (Nölke2017: 229). Ein solche Kritik ist originell, aber leicht zu wiederlegen (vgl. neben zahlreichen öffentlichen Äußerungen und Pressemitteilungen,Reformvorschläge für Alternativen zum Exportmodell in Riexinger/Becker 2017 [4]; Riexinger 2018[5]).
Das „kommunitaristische“ Profil zeichnet sich vor allem durch eine restriktivere Einwanderungs- und Sicherheitspolitik aus. Nölke verbindet eine deutliche Absage an den rechten Kulturkampf und die Annahme einer kulturell homogenen Nation damit, dass die Aufnahme von Geflüchteten und Zuwanderung streng begrenzt werden sollen. Zur Begründung dient die Krisendiagnose „unkontrollierte Masseneinwanderung“ (Nölke 2018: 190). Die vermeintlich „unkontrollierte Masseneinwanderung“ durch die Aufnahme von Geflüchteten wird als Gefahr für Sozialstaat, die Sicherheit(steigende Kriminalität durch unkontrollierte Zuwanderung junger Männer), die demokratische Legitimität (Vertrauensverluste in Rechtsstaat und Demokratie) und für den Zusammenhalt der EU sowie als Ursache für wachsende Ungleichheit in der Gesellschaft wie global (brain drain) ausgemacht und als ein demokratischer Kontrollverlust dargestellt, der sich nicht wiederholen dürfe. Der Umgang mit „dem Islam“ wird primär auf die Perspektive „Gefahren für die eigene Sicherheit zu reduzieren“ verengt (ebd.: 187).
Antimuslimischer Rassismus, der vielen sozialwissenschaftlichen Untersuchungen zur Folge rasant zunimmt, wird nicht als Problem benannt, sondern weitgehend auf Angst vor dem Fremden reduziert, der mit liberaler Integrations- und restriktiver Sicherheitspolitik begegnet werden könne. Auch wenn Nölke sich deutlich von rechtspopulistischen Positionen abgrenzt, bleibt er erstens der Kulturalisierung der Klassenfrage befangen, indem er eine Grenzziehung zwischen den Geflüchteten, ArbeitsmigrantInnen und der einheimischen Mehrheit der Lohnabhängigen bekräftigt. Zudem bedient er sich zweitens eines zentralen rechten Kampfbegriffs, dessen Monopol offenbar den Rechten entwendet werden soll.
Konflikte um das Verhältnis von Einwanderungsgesellschaft und „Klassenfrage“, das Verhältnis zum „Linksliberalismus“sowie die Möglichkeit einer „Rückkehr“ zu nationalstaatlicher Souveränität als Grundlage für einen neuen sozialstaatlichen Kompromiss zwischen Kapital und Arbeit durchziehen SPD, die LINKE und die gesellschaftliche Linke insgesamt schon seit längerer Zeit. Es ist aber eine qualitativ andere Entwicklung, wenn diese Fragen zu einem Deutungskampf darüber, was heute links,sozialdemokratisch und liberal ist, zugespitzt und medial inszeniert werden. So soll mit dem Mittel der intellektuellen Zuspitzung ein zivilgesellschaftliches Umfeld und eine soziale Basis für ein neues politisches Projekt geschaffen werden.
4.Ein Spaltungsprojekt für eine neue Partei?
Die von Wagenknecht, Lafontaine, Nölke, Stegemann und Streeck gewünschte Veränderung des Feldes der Sozialdemokratie als gesellschaftliche Strömung kann nicht allein als intellektuelles Diskursprojekt wirksam werden. Das wissen die InitiatorInnen als politische Profis allemal. Anfang des Jahres starteten Sarah Wagenknecht und Oskar Lafontaine gekonnt einen ersten Testballon, als sie von der Notwendigkeit einer linken „Volkspartei“ sprachen. Damit wurde der öffentliche Diskurs eröffnet, Aufmerksamkeit generiert und Resonanz getestet,mit dem Ziel ein neues politisches Projekt auf die Schiene zu setzen. Dieses Projekt lässt sich als(mittelfristige) Re-Vitalisierung der Sozialdemokratie als gesellschaftliche und parteiförmige Kraft begreifen. Die Hypothese, die zu der Gründung von Aufstehen führte ist offenbar, dass eine neue sozialdemokratisch-kommunitaristische „Volkspartei“ zumindest möglich ist.
Schon jetzt haben sich die InitiatorInnen von „Aufstehen“jedoch in eine Sackgasse manövriert: Als reine außerparlamentarische Bewegung wird „Aufstehen“ absehbar nicht den Druck entfalten können, der notwendig ist,um SPD und Grüne zu erneuern. Ohne die Aussicht auf eine neue Parteigründung droht das mediale Interesse weiter zu versiegen. Hinzu kommt: Selbst wenn die Organisation einen derzeit wenig wahrscheinlichen neuen Aufschwung und über 300.000 UnterstützerInnen erreichen sollte, die dann auch noch aktiv werden,werden diese nicht alle in eine Partei eintreten wollen. Die bisherige Einschätzung der InitiatorInnen von „Aufstehen“ ist ja gerade, dass die LINKE,der im Westen immer noch Image des Realsozialismus unterstellt werde (so Nölke) und die zu radikal sei (so Nölke und Flassbeck), nicht geeignet ist für ein mehrheitsfähiges Projekt einer neuen Sozialdemokratie. Die SPD wird jedoch ungemein schwerer zu „knacken“ sein. Zudem lassen sich auf der Grundlage des von Wagenknecht, Stegemann, Nölke und Streeck vage skizzierten Projekts nicht die Differenzen mit linken Grünen und linken SPDlerInnen in Kernfragen der Wirtschafts-, Europa- und Außenpolitik sowie der Migrations- und Geschlechterpolitik überwinden.
Die politische Lage und die öffentliche Debatte haben sich aber seit September deutlich verändert. Mit Merkel ist der AfD ein wichtiges Symbol abhanden gekommen. Die Wahlen Bayern und Hessen haben gezeigt, dass die Polarisierung in der Gesellschaft derzeit nicht alleine entlang der sozialen Verteilungsfrage verläuft, sondern diese durch eine Konfliktlinie entlang der Verteidigung der „offenen Gesellschaft“ widersprüchlich überlagert wird. Auf dem Pol „gegen rechts“, ist die soziale Frage jedoch mindestens als Forderung nach Solidarität und „sozialem Zusammenhalt“ wichtig und mehrheitsfähig. Zugleich gelingt es der AfD einen Teil der ArbeiterInnenschaft zu erreichen. Aber: Viele Frauen, Gewerkschafterinnen, Lohnabhängige in urbanen Räumen und unter 40 haben eher Grüne als SPD oder AfD gewählt. Der Aufstieg der Grünen zeigt auch, das die InitiatorInnen von Aufstehen ein falsches Bild der gesellschaftlichen Konfliktlinien und des Alltagsbewusstseins der Lohnabhängigen haben. Die Klimafrage und der Kampf gegen Rassismus sind auch für große Teile der Lohnabhängigen zentrale Fragen.
Die Erneuerung der SPD ist weiter durch den Apparat und eine widersprüchliche WählerInnenbasis blockiert. Gleichzeitig gibt es relevante Stimmen in der Sozialdemokratie, die auf eine Erneuerung ohne radikalen Bruch (wie bei Labour in GB) setzen und dabei genau jene Kombination aus moderatem, aber deutlich linkerem Profil in der Sozialpolitik, Stabilisierung des Exportmodells und gesellschaftspolitischer Orientierung an Law and Order und Abgrenzung von Linksliberalismus setzen.
Auch wenn die Chancen für die Gründung einer neuen kommunitaristisch-sozialdemokratischen Partei in den letzten Wochen kleiner statt größer geworden sind, besteht weiterhin die Gefahr, dass „Aufstehen“ zu einem Spaltungsprojekt wird, dass die Linke in Deutschland im Bemühen um eine linke Hegemonie zur Überwindung des Finanzmarktkapitalismus zurückwerfen würde. Eine Parteineugründung würde mit hoher Wahrscheinlichkeit keine 15 Prozent erreichen, zugleich aber die LINKE schwächen. Auch die Gefahr einer Fragmentierung und Schwächung des linken und sozialdemokratischen Spektrums insgesamt sollte nicht unterschätzt werden.
Es gilt die Einheit der LINKEN zu bewahren und zugleich das Bündnis von SozialdemokratInnen, demokratischen SozialistInnen, Libertären und anderenLinken auf der Höhe der gesellschaftlichen Auseinandersetzungen kollektiv weiterzuentwickeln. Statt Parallelprojekte, die am Ende sogar gegen gute Intentionen mancher UnterstützerInnen in Spaltungen münden könnten, sollten wir die Entwicklung zu einer verbindenden, suchenden und aktiven Mitgliederpartei stärken (vgl. online-Fassung).
Dieser Artikel erschien ursprünglich in der November-Ausgabe von „Sozialismus“, einmonatlich erscheinendes Forum für die Debatte der gewerkschaftlichen und politischen Linken in Deutschland. (Probe-)Abos können unter www.sozialismus.de bestellt werden.
Lia Becker ist eine der Bundessprecher*innen der Sozialistischen Linken und arbeitet u.a. zu Klassenpolitik und Hegemonie, Politik um Arbeit und Wirtschaftsdemokratie.
[1] Vgl. dazu die ausführlichere Online-Fassung des vorliegenden Beitrags auf Sozialismus.de.
[2] Andreas Nölke, Linkspopulär. Vorwärts handeln, statt rückwärts denken, Frankfurt a.M. 2017.
[3] https://www.nachdenkseiten.de/?p=40775.
[4] Bernd Riexinger/Lia Becker, For the many, not the few: Gute Arbeit für Alle! Vorschläge für ein Neues Normalarbeitsverhältnis, in: Sozialismus, Supplement zu Heft 9/2017.
[5] Bernd Riexinger, Neue Klassenpolitik. Solidarität der Vielen statt Herrschaft der Wenigen, Hamburg 2018.

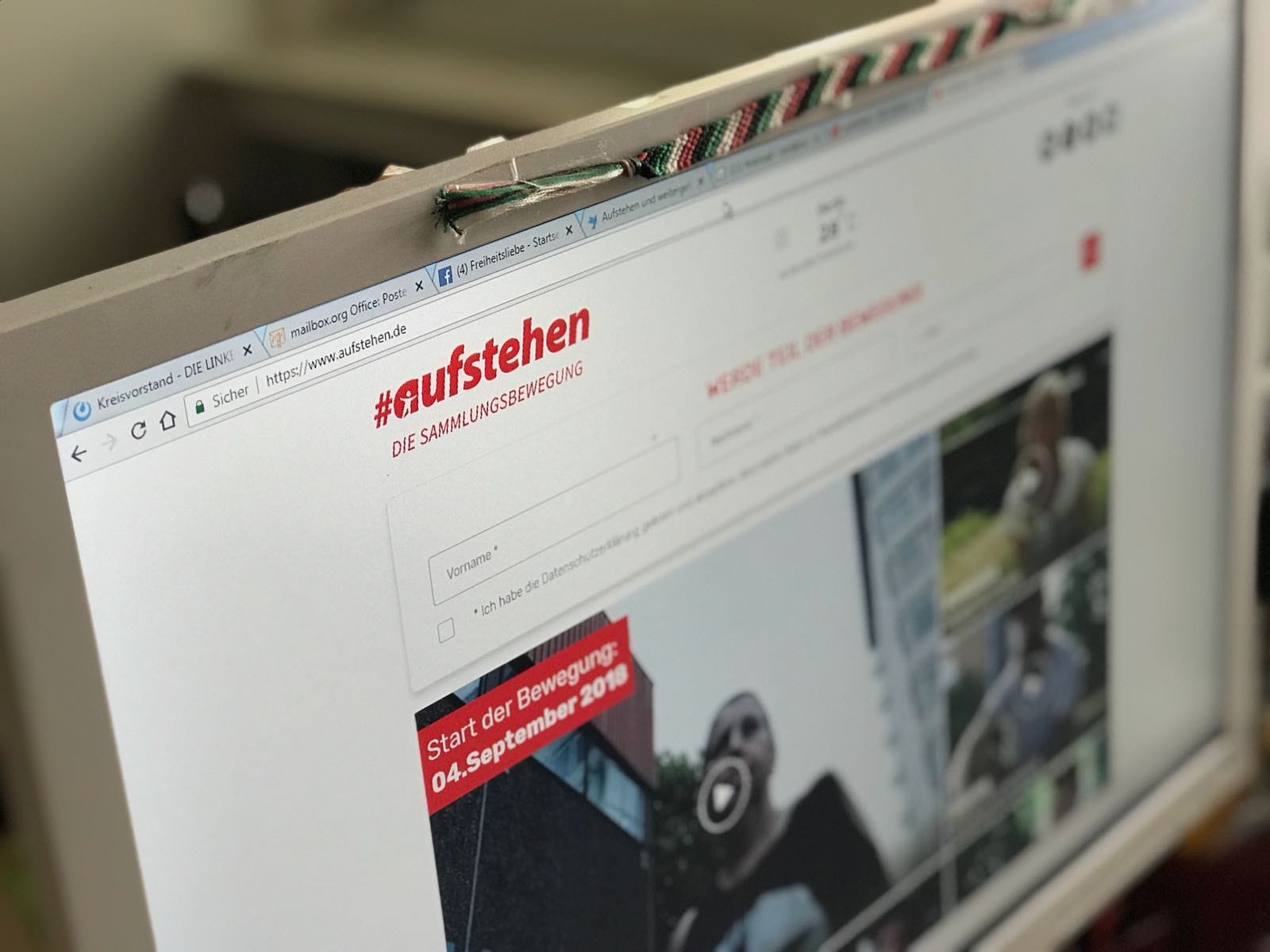






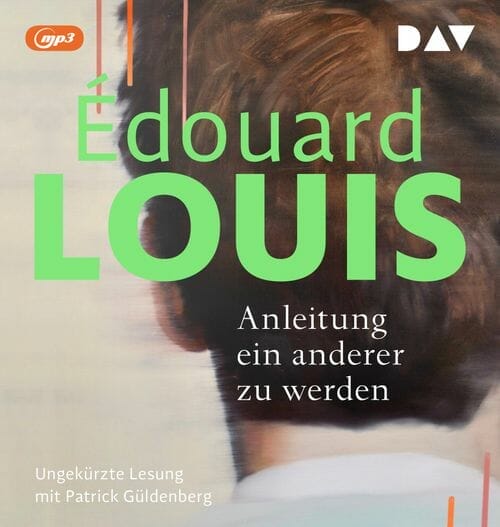



2 Responses
Hallo: Nur e i ne Verständnisfrage: Was soll das sein „sozialdemokratisches intellektuelles Umfeld“? Doch nix Mosaiklinkes was immer das sei? Ist dieses „sozialdemokratische intellektuelle Umfeld“ nicht eher die Wunschvorstellung der Herren Streeck, Flassbeck, Oskar vd Saar, also sowohl irreal als auch im philosophischen Sinn cia, Widerspruch in sich? Gruß, Weiße Weste
Ein Beispiel wie erfolgreiche linke Mobilisierung aussieht kann man aktuell in Belgien verfolgen. Peter Mertens erklärt meines erachtens gut, was Probleme an sind und wie man es schaffen könnte einen größeren Anteil an Wähler zu gewinnen.
https://adamag.de/belgien-ptb-peter-mertens-interview