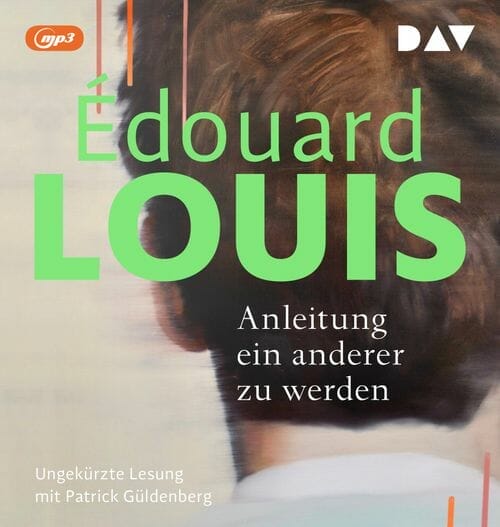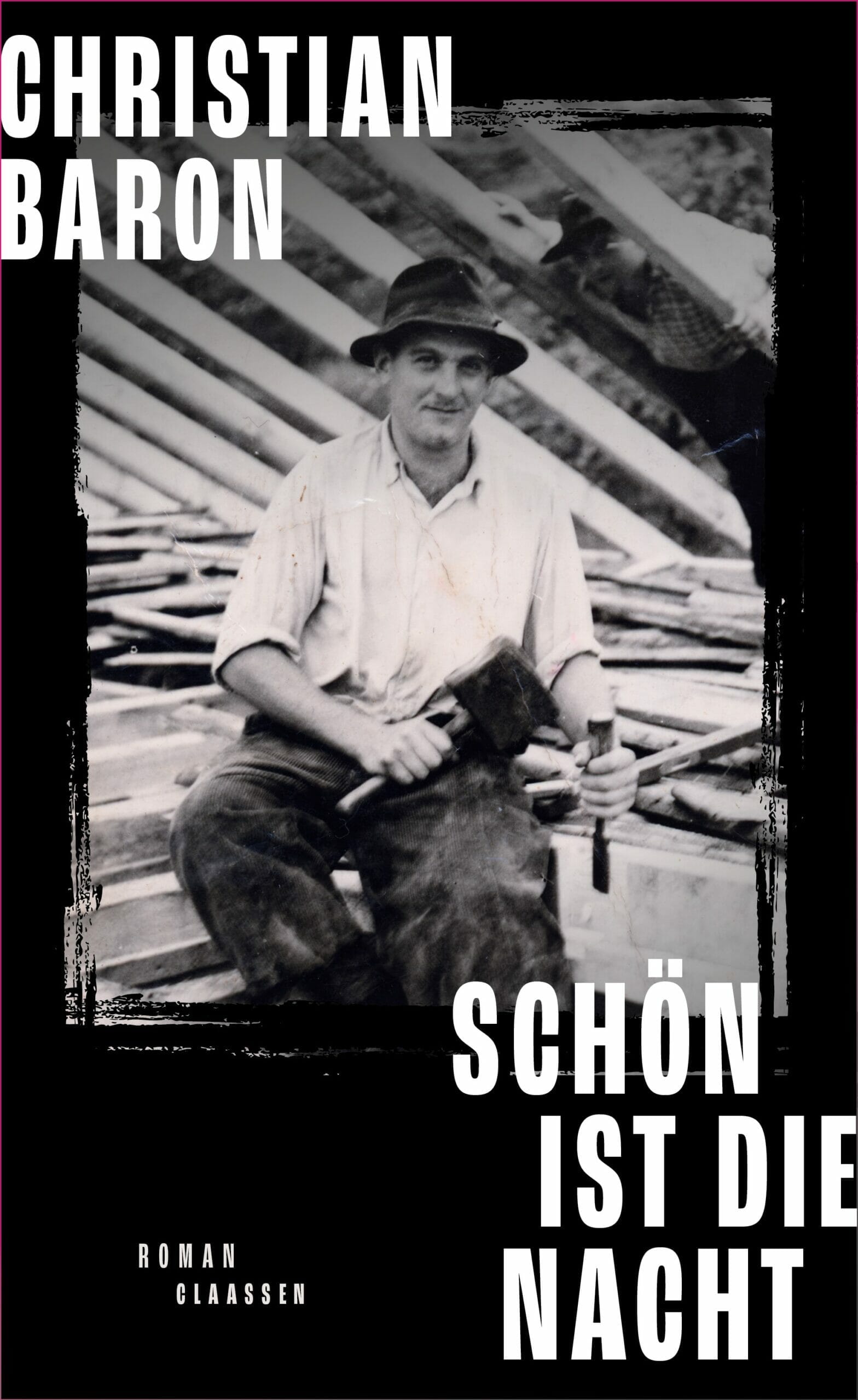Der Wahlerfolg von Donald Trump im mächtigsten Land der Welt ist bislang der Zenit der rechten Wahlerfolge weltweit. Im Schatten der Wiederauferstehung rückwärtsgewandter Kräfte ringt die globale Linke um Antworten. Vor allem aus den USA schwappte im letzten Jahr die Debatte um Identitätspolitik nach Deutschland über.
Losgetreten hatte sie Mark Lilla, ein Professor aus New York. Ein paar Monate nach dem Wahlsieg von Trump legte er sein Buch „The Once and Future Liberal. After identity politics“ vor. Lilla gibt darin den identitätspolitischen Liberalen und Linken eine Mitschuld am Wahlsieg von Trump. Ein harter Vorwurf, den ich anhand von Mark Lillas Buch als Auftakt einer kleinen Artikelserie besprechen will.
Macht statt Abfeiern der Identitäten
Die Webseite der US-Demokraten hat Verweise auf 17 verschiedene Minderheiten, aber keine gemeinsame Erzählung mehr. Trump erreicht daher mit „American great again“ und seiner einfachen Sprache die Arbeiter im Gegensatz zu den Liberalen, so schreibt Lilla als „frustrierter Liberaler“. Die Debatte kommt manchem sicher bekannt vor, nur verwirrt der Begriff liberal. Das amerikanische Wort „liberal“ lässt sich nicht leicht übersetzen, am ehesten entspricht es der Politik der heutigen SPD. Lillas Buch trifft in Zeiten von Erdrutschverlusten der SPD daher auf offene Ohren.
Die verschiedenen identitätspolitischen Gruppen von queer über „native“ bis zu den riesigen Frauenmärschen „women’s marches“ denken nur noch an sich, so Lilla. Sie organisieren sich als neue soziale Bewegungen vor allem an den Universitäten. Sie haben die Arbeiter und die einfachen Menschen vergessen und sprechen auch nicht mehr ihre Sprache. Wenn jemand anders spricht als die Identitätsbewegungen, werden sie wegen fehlender „political correctness“ verdammt. Wer sie kritisiert, ist gleich ein „alter, weißer Mann.“ Statt auf Parteien setzen sie nur noch auf Bewegungen. Dabei vergessen sie, so Lilla, Machtfragen zu stellen und sich um die Besetzung der Institutionen zu kümmern. Ganz dem Slogan „das Private ist politisch“ kümmern sie sich nur um persönliche und kaum noch um große politische Fragen. Lilla gipfelt in den Aussagen: Identitätspolitik ist „Pseudopolitik“ und entpolitisierend: „identity is Reaganism for lefties.“ Statt sich auf das Abfeiern von Identitäten zu konzentrieren, sollten die heutigen Liberalen sich lieber auf die Macht konzentrieren. Wirksamer lassen sich auch Minderheiten nicht schützen.
Denken alle nur noch an sich?
Der schärfste Vorwurf von Lilla ist der Egoismusvorwurf. Die neuen Bewegungen beschäftigen sich nur mit sich selbst. Waren Martin Luther King und Angela Davis, VertreterInnen der Schwarzen- und letztere auch der Frauenbewegung also einfach nur große EgoistInnen? Lilla verneint das. Die Frauen- und Schwarzenbewegung hätte noch ein berechtigtes Anliegen gehabt, aber ab den 70ern habe die Identitätspolitik überhandgenommen. Ob er jetzt die Schwulenbewegung oder die aufkommende Bewegung der „Native Americans“ meint, wird nicht ganz klar. Lilla schaut sich die Bewegungen auch nicht wirklich an. Letztlich wirft er aber den Minderheitenbewegung vor, sie denken nicht ans große Ganze und nur an ihre eigenen Vorrechte. Dabei verdreht er den Zusammenhang. Die Schwarzen– und die Frauenbewegung haben der Gesellschaft zu Recht vorgehalten, dass sie nur an weiße Männer aus den Oberklassen denkt. Hinter dem großen Freiheitsversprechen in den USA verbargen sich auch nach dem 2. Weltkrieg noch Rassen- und Frauenunterdrückung. Egoismus kann man Bewegungen, die für gleiche Rechte kämpfen, also kaum vorhalten.

Mark Lilla selbst hebt die alte Partei der Demokraten in den 50er und 60ern hervor. Statt nur von den Universitäten kamen die Aktivposten oder Kader der Demokraten aus den Gewerkschaften oder politischen Gruppen. Dabei übersieht Lilla, dass gerade die Arbeiter die erfolgreichste Identitätspolitik machten und sich auch daurch als machtvolle Gruppe formierten und organisierten. Nicht selten übersahen die Arbeiterorganisationen aber die Anliegen ihrer weiblichen und schwarzen Mitglieder. Nun machten es den Arbeitern eben genau diese „übersehenen“ Gruppen teils sehr erfolgreich nach. Was Lilla außerdem übersieht, dass zu den erfolgreichsten Zeiten der Linken im 20. Jahrhundert die Anliegen von ArbeiterInnen, Frauen und anderen Gruppen oft zusammenliefen. Das war nie konfliktlos, aber oft erfolgreich. Für sich allein genommen, können alle Gruppen wenigstens zum Teil kapitalistisch eingefangen werden. Einige einzelne Frauen, Schwarze und andere haben in den letzten Jahren politische und wirtschaftliche Chefposten bekommen, während der Großteil weiterhin benachteiligt bleibt.
Umso wichtiger wäre also eine wirklich linke klassenpolitische Untersetzung genau dieser Anliegen, aber das lehnt Lilla als marxistisch beschränkt ab. Das Gemeinsame sieht er lediglich in der patriotischen Beschwörung solidarischer Bürgerschaft („citizenship“). Die Bewegungen sollen weniger fragen, was ihr Land für sie tun kann, sondern was sie für das Land tun können. Wenn nichts mehr weiterhilft, hilft nur noch Patriotismus. Schade eigentlich, eine wirkliche Antwort wäre spannend gewesen. Die bloße Aufzählung von Gruppen aber – da hat Lilla Recht – macht noch keine starke politische Kraft.
Der alte, weiße Mann und die political correctness
Die Fixierung neuerer Bewegungen auf das Ich, „was kann ich tun“ wird gerade viel in der Klimabewegung diskutiert. Doch die meisten wichtigen großen Fragen werden gesellschaftlich und nicht auf der individuellen Ebene geklärt, auch da hat Mark Lilla Recht. Natürlich hat jede/r von uns schon mal besonders vorlaute besserwisserische Linke getroffen, die einem über den Mund fahren. Und natürlich haben gerade viele eher akademisch geprägte neue Bewegungen gerade die Klassenfrage vergessen. Junge Linksliberale werfen dann zum Beispiel gerne den Alten vor, dass die Alten hier nicht so sprechen dürften: der alte, weiße Mann. Solche Vorwürfe vergiften die Debatte und manche Linke agieren wirklich unerträglich. Andersrum macht es Lilla aber nicht besser. Er selbst war in den 80ern zur Hochzeit von Reagans Präsidentschaft Redakteur einer neokonservativen Zeitschrift. Wenn also gerade Lilla anderen Bewegungen polemisch „reaganism for lefties“ vorwirft und eine Mitschuld am Aufstieg der Rechten gibt – ohne ein Wörtchen der Selbstkritik – ist das abenteuerlich. Auch, dass älteren weißen Männern das Sprechen verboten würde, entspricht kaum der Realität. Natürlich können sich alte, weiße Männer noch vielfach äußern – bis heute hat keiner von ihnen das Sprechen eingestellt, sondern lediglich ein paar Klagelieder über Sprechverbote für alte, weiße Männer in die langen Reden eingebaut.
Lilla möchte raus aus der liberalen Blase und plädiert für etwas mehr Toleranz für Evangelikale, Waffenbesitzer in den ländlichen Regionen und fordert, weniger auf sie herabzuschauen. Nur verwechselt er da etwas. Er will Evangelikale oder Waffenbesitzer durch Zuhören als WählerInnen zurückgewinnen. Das ist das eine, aber Lilla kritisiert die riesigen Frauenmärsche dafür, die Evangelikalen mit ihrer Anti-Abtreibungsforderung verprellt zu haben. Eine arrogante Haltung ablegen, ist immer richtig. Zentrale linke Positionen zu verwässern, um den Fundis und Rechten entgegen zu kommen, aber sicher nicht.
Neue Bewegungen machtvergessen und ohne Idee?
Zuguterletzt wirft Lilla den identitätspolitischen Bewegungen vor, machtvergessen zu sein. Wer keine Macht hat, kann auch nichts verändern. Die Identitätspolitiker sind aber lieber auf der Straße und in ihrer Blase statt den Staat zu erobern und sich in Parteien zusammenzuschließen. Mit Lilla kann man darüber nachdenken, ob diese Abkehr von den Parteien wirklich geholfen hat. Die Schwäche linker Parteien und der Aufschwung der Bewegungen hängen zumindest zeitlich zusammen. Machtfragen aber nur auf den Staat und die Institutionen beschränken, wie Lilla es tut, ist arg kurzsichtig. Letztlich passiert in den Parlamenten meist nur, was in der Gesellschaft durchsetzungsfähig ist. Fast überall ging aber der Aufstieg der Rechten mit der neoliberalen Wende vormals sozialdemokratischer Parteien zusammen. Sie haben – wie die Demokraten unter Clinton – buchstäblich ihre Wählerschaft verraten. Diesen einfachen Fakt übersieht Lilla bei seiner Suche nach der politischen Verantwortung.

Die eigene Ideenlosigkeit kaschiert Lilla indem er den Sündenbock Identitätspolitik ausmacht. Weder ist klar, wen er damit meint, noch dürfte diese Debatte irgendwen weiterbringen. Lillas Buch ist kein guter Beitrag zur Analyse des Aufstiegs der Rechten, sondern eine innerliberale Schuldzuweisung, die die Gräben innerhalb des linken Lagers vertieft. Mark Lillas Buch ist nicht schlecht, weil er ein alter weißer Mann ist, sondern weil er zwar viele wichtigen Fragen aufwirft, aber nur schlechte Antworten hat.
Ein Präsident Bernie Sanders würde übrigens mehr für die Mehrheit der Schwarzen tun als es Obama je getan hat. Die Bewegung, die ihn trägt, ist aus der Arbeiterklasse, migrantisch, schwarz, ökologisch – ganz ohne Schuldzuweisungen.