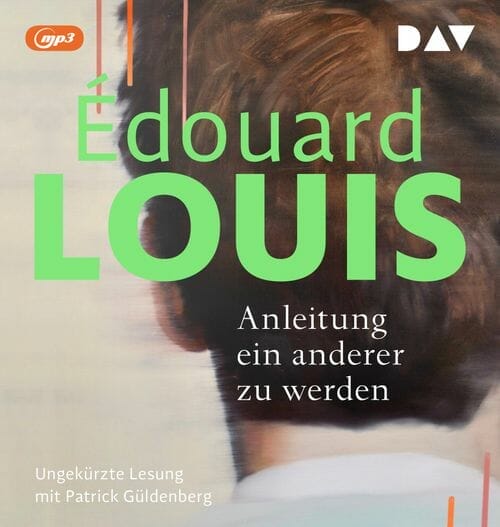Identitätspolitik gibt es aus guten Gründen. Doch uns muss klar sein, dass wir auch und vor allem Universalpolitik brauchen. „Jede Politik ist Identitätspolitik“ – ein Satz, auf den ich zum ersten Mal irgendwann in den 1990ern stieß. Eine Einstellung, wie zugeschnitten auf das Jahrzehnt, in dem Judith Butler jede Identität als Konstruktion postulierte und in Politik lediglich langsame, farblose und eindeutig nicht-revolutionäre Anpassung sozialer Normen erblickte.
Die Idee dahinter hat überlebt. Freilich, weil die mannigfachen politischen Umstände, von denen sie geprägt wurde, immer noch bestehen. Aktuell hallt sie in den Debatten zu den Wahlen 2016 wie in der Diskussion zum Verhältnis zwischen den sozialen Bewegungen der post-1960er und einer erneuerten sozialistischen Linken nach.
Auf den ersten Blick scheint es, die Idee dahinter könnte eine nützliche Zuspitzung darauf sein, wie Politik tatsächlich funktioniert. Benedict Anderson etwa zeichnet in seiner populären Schrift Die Erfindung der Nation nach, wie eine spezifische Form von Identität die Welt geprägt hat. Nach Johannes Gutenbergs Erfindung verbreiteten sich Bücher, Zeitungen, Schulen und andere Institutionen, die traditionelle Axiome untergruben und Menschen dazu verführten, sich unterschiedlichen Gemeinschaften zugehörig zu fühlen. Sie bereitete den Boden für Nationalismus und Aufstieg der Nationalstaaten.
Auch Karl Marx lässt sich als Identitätspolitiker lesen. Wenn seine Anhänger das Klassenbewusstsein definieren als die Entwicklung von der Klasse-an-sich zur Klasse-für-sich, beschreiben sie einen Prozess, in dem die Klassenangehörigen ein Bewusstsein ihrer selbst als Klasse entwickeln und darauf ihre Identitätsgemeinschaft aufbauen.
Jedoch ist es eine grobe Fehlinterpretationen Andersons und Marxens Werke, sie als identitätspolitische Vordenker zu begreifen. Anderson gründet seine Analyse nicht auf einer allgemeingültigen Enstehungstheorie der Identität. Vielmehr zieht er für seine akribische Arbeit politisch-ökonomische Faktoren heran. Besonders hinsichtlich dessen, was er Presse-Kapitalismus nennt.
Wie schon E. P. Thompson bemerkte, lenkt die Verknüpfung von Klassenbewusstsein und Identität von den historischen Umständen und dem Ringen seiner Entstehung ab:
Sobald [dieser Zugang] erst einmal gemutmaßt wird, scheint es möglich, ein Klassenbewusstsein voraus zu setzen, das „sie“ [die Arbeiterklasse] haben sollte, wäre „sie“ sich über ihre eigene Stellung und ihre tatsächlichen Interessen im Klaren. Es gibt eine kulturelle Superstruktur, durch welche diese Erkenntnis getrübt wird. Diese kulturellen „Rückstände“ und Verzerrungen sind ein Ärgernis, die es möglich machen, eine Ersatztheorie zu entwerfen: Parteien, Sekten oder Theoretiker verkünden als Klassenbewusstsein nicht das, was es ist, sondern was es ihrer Ansicht nach sein sollte.
Der Gedanke, in der Politik ginge es immer um „Identität“, ist so allgemein gehalten, dass er als Zugang zu jedem politischen Phänomen herangezogen werden kann. Wie dem auch sei: Jede Bewegung stellt ein „wir“ gegen ein „die“ – und errichtet ihr Fundament aus Menschen, die sich in einer Gruppe engagieren und mit einem bestimmten Punkt identifizieren.
Dass diese Behauptung in so vielen Fällen anwendbar ist, ist keine Stärke. Das Denkmuster verhindert die Analyse partikularer Phänomene für sich, um eine generelle Sachkenntnis und Kompetenz zu heucheln. Sie radiert die historischen Besonderheiten bestehender Kämpfe und Bewegungen aus und schert alles über einen Kamm.
Identität als Kampftaktik
Die Forderungen sozialistischer und Arbeiterbewegungen – wie allgemeine Gesundheitsfürsorge, freie Bildung, öffentliches Wohnungswesen, demokratische Kontrolle der Produktionsmittel etc. – sind selten mit Identitätspolitik zu vereinbaren, wie sie gemeinhin verstanden wird. Identitätspolitik im engeren Sinne bedeutet, dass Randgruppen ihre bis dato stigmatisierten Identitäten annehmen, auf Grundlage gemeinsamer Merkmale und Interessen (die für gewöhnlich als entscheidend und unveränderlich gelten) Gemeinschaften bilden und entweder für ihre Unabhängigkeit oder Rechte und Anerkennung kämpfen. Ich möchte sogar behaupten, dass nicht einmal jene neuen linken Bewegungen, die den Begriff ursprünglich „Identitätspolitik“ geprägt haben, sich immer an diese Definition halten.
Denken wir an die Schwulenbewegung. Während ihrer Entstehungsphase in den 1960ern wurde weniger eine Identität zelebriert, als vordringlich für das Ende von Gewalt und Unterdrückung gekämpft. Zuallererst forderten die Aktivisten, dass die Polizei aus unseren Bars verschwindet, wir von den Behörden in Ruhe gelassen werden und die ständige Angst in unserem Leben ein Ende nimmt.
Die schwule Identität bildet sich früh heraus, für gewöhnlich im Coming out-Prozess und den ihn begleitenden Gesprächen. Wie auch immer, geben uns die frühen Aktivisten keinen Hinweis für eine Suche nach dem, was Nancy Fraser „Anerkennung“ nennt oder definierten ihre Homosexualität als unabänderliche Wesenseigenschaft einer Person.
Henry Abelove legt in seiner Forschung zur frühen Schwulenbefreiung dar, dass wir, entgegen der nach den New Yorker Stonewall-Unruhen gängig gewordenen Vorurteilen, das Verhältnis zwischen den frühen Schwulenaktivisten und der schwulen Identität grundlegend missverstehen. „Ich finde wenig, das mich glauben lässt“, schreibt er, „dass [die frühen Aktivisten] das Coming out für das Ergebnis einer tiefen Wahrheitsfindungsreise ins angeblich innerste Selbst verstanden. Sie begriffen es viel mehr als die Befreiung von bewusster Heimlichtuerei.“ Sich selbst dabei öffentlich zu ihrer Homosexualität zu bekennen, erachteten sie als ein „unabdingbares Mittel“ für den Aufbau einer politischen Bewegung, als behutsame aber bleibende Verwandlung des Einzelnen zu einer Waffe im gemeinsamen Kampf.
Unter anderem bedeutet es, dass die frühe Befreiungsbewegung eine grundlegend dialektische Position zur Sexualität einnahm. Am Anfang war es ihr Ziel, dass Zuschreibungen wie „hetero-“ und „homosexuell“ nach der Befreiung gänzlich verschwinden.
Carl Wittmans einflussreiche Schrift A Gay Manifesto, veröffentlicht 1970 von der Red Butterfly-Gruppe der Gay Liberation Front, gewährt einen nützlichen Einblick in das Denken der frühen Aktivisten. Weit davon entfernt, San Francisco als Schwulenheimat zu feiern, betrachtet er die Stadt als eine Art Flüchtlingscamp. Er lehnt die Schwulenheirat als politisches Ziel ab und fordert stattdessen Alternativen zum traditionellen Ehekonzept an sich. Und derweil er das Coming out als aktuell politische Notwendigkeit heraushebt, betont Wittman den provisorischen Charakter der homosexuellen Identität und richtet seinen Blick auf eine befreite, bisexuelle Zukunft: „Wir werden nur so lange schwul sein, bis jeder vergessen hat, dass das ein Problem ist.“ Ähnlich äußert sich Dennis Altman in seiner 1971 erschienen Polemik Homosexual. Oprression and Liberation. Er schließt mit dem Kapitel Das Ende der Homosexualität.
Das Ziel, mit dem diese Aktivisten ihre schwule Identität annahmen, war sie schlussendlich abzuschaffen. Sie wurden von marxistischen Ansätzen zum Klassenkampf beeinflusst – die, ganz ähnlich, schlussendlich in der Abschaffung aller Klassen an sich gipfeln. Sie sammelten sich um Forderungen nach angemessenem Einkommen, Wohnraum, medizinischer Versorgung, Umweltschutz und sinnstiftender Arbeit. Endlich war ihr Befreiungskampf ein revolutionärer Aufruf zur Tat – mit einem universellen Begriff von Freiheit.
Die Kehrtwende zu Identität als eigenständiges, politisches Schlüsselmoment, genau wie der Zuschnitt des Forderungskatalogs auf dieses engstirnige Konzept, geschah während des politischen Aufstiegs. Als die städtischen Schwulencommunities wuchsen. Als ein schwuler Nischenmarkt entdeckt wurde. Als der politische Diskurs von der sozialen zur persönlichen Befreiung kippte. In dieser Atmosphäre erscheinen immer mehr gereifte Identitäten, von denen eine jede unter einer umso mehr und mehr vertrackten Abkürzung mit den anderen um Anerkennung wetteifert. Eine unüberschaubare Geschichte von Spaltungen, Nationalismen und Intersektionalismen ist die Folge.
Universelle Befreiung
Alle neueren linken, sozialen Bewegungen verfolgen ähnliche Wege. Im Verlauf der 1970er Jahre haben sich die ursprünglichen, radikalen Standpunkte der Frauen-, Schwarzen- und Schwulenbewegungen hin zu im Grunde liberalen Weltbildern entwickelt. Je mehr gesamtpolitische Vorstellungen zurückgingen, umso mehr machte es sich eine jede in ihrem jeweiligen Identitätskonzept bequem. Dieser Prozess ging Hand in Hand mit dem Ende des Fordismus und den neuen Formen eines neoliberalen Konsum-Lifestyles. Dieser Trend wurde von regelmäßig wiederkehrenden, radikalen Aufwallungen unterbrochen. Aber diese Ausbrüche wurden ruhig gestellt, gezähmt und vom Mainstream wieder aufgesogen.
So gesehen ist Identitätspolitik weder der übrigen Politik nahe noch ein Politikstil, der von den neuen, linken Bewegungen ausnahmslos übernommen wurde. Eher beschreibt sie die Form, die diese Bewegungen unter den sich verändernden Bedingungen angenommen haben.
Diese Entwicklung hat zu wichtigen Ergebnissen geführt. Wir verdanken den Erfolgen der Identitätspolitik und der von ihnen angestoßenen liberalen Reformen, dass Toleranz und Inklusion in den Vereinigten Staaten zugenommen haben.
Aber dieses Engagement hat gleichzeitig versagt, sich mit jenen Formen sozialer Ungerechtigkeit auseinanderzusetzen, die frühere Befreiungsbewegungen in den Mittelpunkt ihrer Aktivitäten stellten. Heute, unter den Bedingungen eines noch verschärften Klassenkampfes, verbünden sich Politiker des Establishments ihrer eigenen Ziele willens mit verschiedenen Identitätsgruppierungen: Den Neoliberalismus gegen jeden Widerstand durchzusetzen.
Wir müssen der Identitätspolitik den ihr gebührenden Respekt zollen. Aber genauso müssen wir uns ihrer Grenzen bewusst sein. Wir können aus der Vergangenheit lernen, aber nicht aus eingekapselten Geschichten, die Identität zu abstrakten Werten an sich erklären. Und wir belügen uns selbst mit dem Glauben, der Weg voran bedeutete die Aufhäufung von Minderheiten zu einer Mehrheit, die Verschmelzung zuvor gefestigter Identitäten zu einer sozialistischen Bewegung.
Die Linke muss lernen, wie die derzeit von verschiedenen Identitätsmaklern beherrschte und zersplitterte Öffentlichkeit mit einem umfassenden und universellen Programm gewonnen werden kann.
Über den Autor
Roger Lancaster ist Professor für Anthropologie und Kulturstudien an der George Mason-Universität. Von ihm erschien unter anderem Sex Panic and the Punitive State, Berkeley 2011. Der Artikel erschien im JacobinMag
Übersetzt von David Danys.