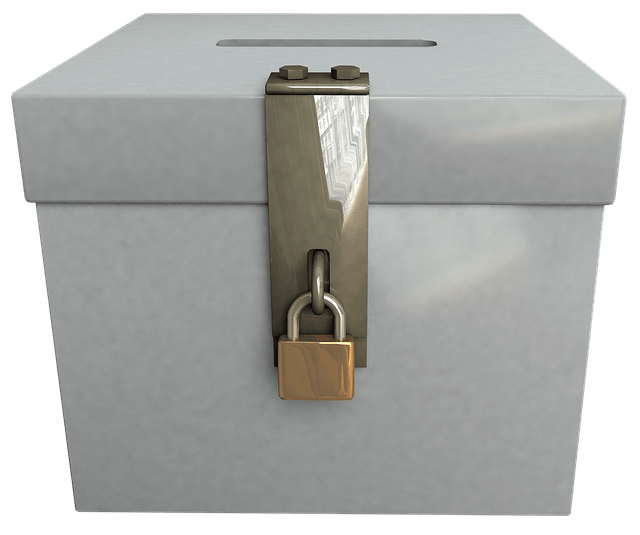Kein Buch wurde in den letzten Jahren unter Linken in Deutschland mehr diskutiert und gelobt als »Rückkehr nach Reims« von Didier Eribon. Wir sprachen mit dem Soziologen Thomas Goes, der wie Eribon aus einer Arbeiterfamilie stammt und heute an der Uni forscht, über die Lehren aus der Debatte für DIE LINKE. Er plädiert für eine populare Klassenpolitik und erklärt, warum es dafür einer innerparteilichen Kulturrevolution bedarf.
Thomas Goes forscht am Soziologischen Forschungsinstitut (SOFI) Göttingen zu Kapitalismus, Arbeitsbeziehungen und zum Bewusstsein von Lohnabhängigen. Vor kurzem veröffentlichte er gemeinsam mit Violetta Bock das Buch »Ein unanständiges Angebot? Mit linkem Populismus gegen Eliten und Rechte«.
Das Buch »Rückkehr nach Reims« von Didier Eribon ist eine Mischung aus soziologischer Studie und erzählender Autobiografie. Eribon, der aus einem klassischen Arbeiterhaushalt stammt, analysiert seine »gebrochene Klassenidentität«. Auch du kommst aus einer Arbeiterfamilie und forscht heute an der Universität. Hast du dich in Eribons Beschreibungen wiedererkannt?
Thomas Goes: Ja, sehr sogar. Wir kommen, wenn auch zeitversetzt, sogar aus demselben Klassenmilieu – bildungsfern, wie das in Herrschaftssprache so schön heißt. Wiedererkannt habe ich insbesondere die Fremdheit im akademischen Milieu, ein Unbehagen an der eigenen Linken und die Entfremdung von der eigenen Familie und der Herkunftsklasse, auch wenn das in meinem Fall nicht so tief reicht.
Woran liegt das?
Das hat sicherlich damit zu tun – und das ist ein ziemlicher Unterschied zu Eribon –, dass ich keine starken Missachtungserfahrungen machen musste. Ich war weder ein intellektueller Sonderling, noch schwul. Deshalb kenne ich zwar schmerzhafte Entfremdung und auch Sprachlosigkeit, aber gebrochen habe ich nie. Es sind darum auch immer »meine Leute« geblieben. Rassismus und Sexismus, wie Eribon das beschreibt, kenne ich natürlich auch vom Küchentisch. Aber ich muss sagen, dass ich auch das Andere kennengelernt habe: Solidarität, Nächstenliebe, Großzügigkeit, eine bestimmte Neigung zum aufrechten Gang.
Für Eribon war der Marxismus, wie er ihn an der Universität in Paris kennenlernte, ein Instrument der intellektuellen Abgrenzung gegenüber seiner eigenen Familie, also beinahe eine Antithese zur real existierenden Arbeiterklasse. Was war dein Zugang zum Marxismus?
Das war in meinem Fall anders. In meiner Familie gibt es eine kommunistische Tradition, das Dorf, in dem ich groß geworden bin, hatte eine der größten Landgruppen der KPD in der Weimarer Republik. Den Faschisten galt es als »Zigeunerdorf« und Hochburg »asozialer Roter«. Ich habe das schon als Kind mitbekommen, weil ich mich früh für Geschichte interessierte und meine Großeltern mir einen instinktiven Antifaschismus vermittelt haben. Ich hatte deshalb als Heranwachsender einen eigentümlich positiven Bezug zum Kommunismus. Politisiert habe ich mich dann aber durch Antirassismus und Antifaschismus Anfang der 1990er.
Also keine Rebellion gegen das Elternhaus?
Doch, erstmal bin ich dann Öko und Anarchist geworden. Marx habe ich das erste Mal mit 16 gelesen, aber wirklich dafür interessiert habe ich mich erst, als ich zufällig auf einem Flohmarkt Ernest Mandels dicke »Marxistische Wirtschaftstheorie« gekauft habe. Da war ich schon 19. Und dann hatte ich irres Glück an einer Universität zu studieren, an der es noch etliche linke Professoren gab.
Dann war die Entdeckung des Marxismus für dich, im Gegensatz zu Eribon, eine Hinwendung zur Arbeiterklasse?
Mir hat der offene Marxismus, wie ich ihn damals begriffen habe, eher geholfen meine Familie und das Klassenmilieu, aus dem ich komme, besser zu verstehen. Das war eher eine kritische Auseinandersetzung als eine ide alisierende Abstraktion, glaube ich. Ich habe den Marxismus als Theorie und Praxis der Befreiung kennengelernt – eine Befreiung, die nur von unten kommen kann. Mich hat dieser offene Marxismus also eher wieder mit der Klasse, aus der ich komme, verbunden.
alisierende Abstraktion, glaube ich. Ich habe den Marxismus als Theorie und Praxis der Befreiung kennengelernt – eine Befreiung, die nur von unten kommen kann. Mich hat dieser offene Marxismus also eher wieder mit der Klasse, aus der ich komme, verbunden.
»Rückkehr nach Reims« ist in der deutschen Linken eingeschlagen wie eine Bombe. Wie erklärst du dir die gewaltige Resonanz?
Das Buch befriedigt offenbar verschiedene Bedürfnisse. Etwa das einer journalistischen Öffentlichkeit, die sich den Aufstieg der extremen Rechtenleicht verständlich zu erklären versucht. Und dann natürlich von verschiedenen Strömungen der Linken, die darüber streiten, wie eine angemessene Antwort gegen die Rechte auszusehen hat. Dabei geht es um die Frage, wie wir es denn nun mit den arbeitenden Klassen halten sollten, bzw. wie ein emanzipatorisches linkes Projekt es mit ihnen halten kann.
Wie kommt es, dass sich so unterschiedliche Strömungen der Linken positiv auf Eribon beziehen?
Bei ihm werden Leute wie ich fündig, die für eine stärkere Klassenorientierung und eine Modernisierung popularer Klassenpolitik sprechen. Es reiben sich aber auch diejenigen die Hände, die praktisch das glatte Gegenteil davon sagen. Insbesondere die Passagen, in denen Eribon die traditionelle Arbeiterklasse als »immer schon« rassistisch beschreibt, werden da gerne gelesen.
Bedient er das Klischee vom ungebildeten, rassistischen, sexistischen und homophoben Arbeiter?
Ja und Nein. Es gibt einen antiemanzipatorischen Kern bei Eribon. Rassismus und Sexismus gab es in der Arbeiterklasse immer und beides müsse man neutralisieren – so lese ich ihn. Was heißt »neutralisieren«? Natürlich gibt es Rassismus und Sexismus in allen Gesellschaftsklassen. Aber nicht die gesamte Arbeiterklasse ist rassistisch. Durch seinen Stil – er entwickelt weitreichende Thesen durch die Auseinandersetzung mit seiner eigenen Familie – legt er nahe, er würde sowas behaupten. Ich glaube aber nicht, dass er das so vertreten würde. Trotzdem befriedigt er diverse Stereotype über die neuen gefährlichen Klassen, die »Prolls« und die neue Unterschicht.
Kommt daher die Anschlussfähigkeit an den bürgerlichen Diskurs? Immerhin wurden Eribons Thesen auch in allen großen deutschen Tageszeitungen diskutiert und vielfach gelobt.
Das ist sicherlich einer der Gründe dafür, ansonsten ist es natürlich ein schön geschriebenes Buch, das kleinbürgerlichen und bürgerlichen Intellektuellen das Gefühl vermittelt, etwas über »die Arbeiter« zu lernen. Und unabhängig von den antiemanzipatorischen Zwischentönen des Buches darf man Rassismus und Sexismus innerhalb der der arbeitenden Klassen natürlich auch nicht bagatellisieren. Neben politisch recht fortschrittlichen Teilen existieren ja nicht nur breitere Schichten, die über ein sehr ambivalentes und widersprüchliches Alltagsbewusstsein verfügen, sondern auch solche mit verfestigten rassistischen und autoritären Anschauungen. Emanzipatorische Klassenpolitikmüsste versuchen die Autoritären und Rassisten zu isolieren. Das geht aber nur, wenn sie die Fortschrittlichen organisiert und die, die ein ambivalentes und widersprüchliches Bewusstsein haben, zu gewinnen versucht. Tut man das nicht, dann bereitet man tatsächlich der radikalen Rechten den Boden.
Das ist die Kernfrage in »Rückkehr nach Reims«: Warum geben große Teile der Arbeiterklasse heute der Rechten ihre Stimme. Für Eribon hat das vor allem mit einem Verlust der Klassenidentität zu tun. Überzeugt dich das?
Nein. Eribon beschreibt ja im Prinzip in Ansätzen, wie aus einer »politisch befestigten ArbeiterInnenbewegung« eine wurde, der es an Stolz, Selbstvertrauen und – das ist wichtig – wirksamen Instrumenten fehlt, die eigenen Interessen durchzusetzen. Er nennt da nicht zuletzt die Abwendung der Linken von der Arbeiterklasse. Fehlende Repräsentation durch die Linke zum Problem zu machen, halte ich für richtig. Das haben auch soziologische Forschungen gezeigt. Man spricht etwa von einer »populistischen Lücke«, weil traditionelle Linksparteien Ansprüche der unteren Volksklassen nicht nur nicht mehr vertreten, sondern die Seiten gewechselt haben. Im Fall der Sozialdemokratie ist das ganz einfach nachzuvollziehen, da sie – etwa in England, Spanien oder auch Deutschland – als modernisierte Marktsozialdemokratien die Neoliberalisierung mit vorangetrieben haben. So ähnlich ist es mit einigen kommunistischen Parteien gewesen, etwa einem großen Teil des PCI in Italien, dessen rechter Flügel heute gemeinsam mit Resten der alten Christdemokratie eine Partei macht. Das ist aber nur die eine Seite. Denn seit Anfang der 1990er ist ja auch ein breites Spektrum an neuen Linksparteien entstanden, ich denke an den Bloco in Portugal, an die mittlerweile gescheiterte Rifondazione in Italien, an die Rot-Grünen Einheitslisten in Dänemark oder auch an DIE LINKE in Deutschland. Die alten Linksparteien als Klassenparteien ersetzen konnten sie aber alle nicht. Die Frage lautet also: Warum hat es die Linke jenseits von Sozialdemokratie und den alten Kommunistischen Parteien nicht geschafft, eine mobilisierende Klassenpolitik zu erfinden?
Und worauf führst Du das zurück?
Ich denke, man muss sich die subjektiven Verarbeitungsweisen der Neoliberalisierung in den arbeitenden Klassen genauer anschauen. Und da zeigen sich dann kompliziertere Herausforderungen. Ich will nur ein paar anreißen: Zunächst einmal heißt Neoliberalisierung Ausweitung von Kapitalmacht. Das wirkt zutiefst verunsichernd und konkurrenzsteigernd. In vielen Ländern sind alte Solidarkollektive auch schlicht zerrissen – das hat was mit der Veränderung der Klassenzusammensetzung zu tun. Man denke an die Niederlagen der Arbeiterklassen im Ruhrgebiet. Gleichzeitig sind neue Sektoren der Klasse entstanden, allerdings unter sehr schwierigen Bedingungen: Vor allem im Dienstleistungssektor, aber auch an den flexiblen Rändern der Exportindustrie. Ich will hier keinen Niedergangsgesang anstimmen, aber das ist ein wichtiger Punkt: Wir haben eine Geschichte von sanften Niederlagen hinter uns, nur sehr wenige ausstrahlende Erfolgsbeispiele, die zeigen, dass wir gewinnen können. Eine weit verbreitete Verarbeitungsweise ist darum auch Resignation, Ohnmachtsgefühle. Das ist freilich nirgendwo flächendeckend so – wäre dem so, dann hätten wir noch schwächere Gewerkschaften, als jetzt schon. Die Gegentendenz gibt es auch, aber sie war bis dato eher schwach.
Wie gelingt es der Rechten an diesem Ohnmachtsgefühl anzusetzen?
Die extreme Rechte kann paradoxerweise an alte verkürzte sozialdemokratische Werte anknüpfen und sich gleichzeitig bei Ideologien bedienen, die von neoliberalen und imperialistischen Kräften vertreten werden. Das ist beides wichtig. Zum Ersten: Da, wo Rechtspopulisten oder Postfaschisten die soziale Frage entdecken und stark machen, benehmen sie sich wie eine »Sozialdemokratie nur für Deutsche oder nur für Franzosen oder nur für Dänen«. Natürlich nicht in dem Sinne, dass sie sozialdemokratisch argumentieren. Aber sie predigen dann exklusive Solidarität. Das wirkt durchaus anziehend auf Menschen, die unter der Neoliberalisierung leiden. Und zum Zweiten: Dabei können sie an diverse neoliberale und imperialistische ideologische Versatzstücke anknüpfen. Ich meine nicht nur die sozialdarwinistische Leistungsethik, sondern ich meine etwa den Standortnationalismus, der dem kapitalistischen Wettbewerbsstaat innewohnt oder den antimuslimischen Rassismus, der mit dem »Krieg gegen den Terror« durch die Zivilgesellschaft geblasen wurde. Mit anderen Worten: Man bricht ja gerade keine Tabus, wenn man Arbeitslose abwertet, wenn man für Arbeit zuerst für Deutsche ist oder wenn man gegen Muslime hetzt.
Also hat die exklusive Solidarität der Rechten gegenüber einer umfassenden Solidarität der Linken einen strukturellen Vorteil?
In gewisser Hinsicht, ja. Allerdings gibt es auch Verarbeitungsweisen der Neoliberalisierung, die Brücken nach links darstellen. Insgesamt sind jedoch sowohl klar linke und klar rechte Verarbeitungsweisen die Ausnahme, die Regel sind eher widersprüchliche Mischformen. Und es ist gänzlich falsch anzunehmen, dass exklusiv-solidarische Verarbeitungsweisen umso größer sind, je weiter unten man in der Klassenstruktur man schaut. Es gibt auch einen Rechtspopulismus der »Mitte«, der sich einfach anders ausdrückt – etwa mit stärkeren Abneigungen gegen angeblich Faule oder solche, die zusätzliche Lasten bringen. Worüber wir recht wenig wissen, ist der Autoritarismus und Rassismus in den Funktionseliten der Republik und in den verschiedenen Fraktionen des Blocks an der Macht.
Wie sollte die Linke auf das Ausgreifen der Rechten in die Arbeiterklasse reagieren?
Die Rechte schlagen werden wir nur, wenn wir eine populare Bewegung aus den unteren Volksklassen schaffen, die das Spektrum gewinnen kann, das sich zwischen den Polen klar rechter oder linker Verarbeitugsweisen bewegt. Das hieße allerdings nicht nur eine stärkere Orientierung auf die Arbeiterklasse, sondern auch eine gezielte Bündnisstrategie gegenüber dem lohnabhängigen Kleinbürgertum, also leitenden Angestellten, Lehrern oder Technikern und Ingenieuren oder den neuen Selbständigengruppen.
Bedeutet eine stärkere Orientierung auf die Volksklassen, weniger über Feminismus, Ökologie, Rassismus und Krieg zu sprechen und mehr über die soziale Frage?
Nein. Ich wüsste auch nicht, wie eine nicht-feministische, eine nicht anti-rassistische und eine nicht-ökologische Klassenpolitik uns weiterbringen könnten. Dafür gibt es mehrere Gründe. Zunächst einmal, weil die Volksklassen in Deutschland ja nun nicht nur aus Männern und angeblichen Bio-Deutschen in der zwanzigsten Generation bestehen. Wenn also Frauen und Menschen mit Migrationshintergrund ausgebeutet werden, wie könnten wir dann keine feministische und auch antirassistische Klassenpolitik machen? Dass die meist von Frauen geleistete Reproduktionsarbeit notwendig ist für die Reproduktion von Klassenverhältnissen, will ich nur noch der Vollständigkeit halber sagen. Und als altmodischer Marxist will ich natürlich alle Verhältnisse umwerfen, in denen Menschen erniedrigt und unfrei sind. Und ehrlich, wer heute kein Ökosozialist ist, hat schlicht nicht verstanden, dass es nicht die Frage ist, ob wir epochalen Natur- und Lebensmittelkrisen entgegenschreiten, sondern wieviel Zeit wir noch haben, das Schlimmste zu verhindern.
Ein wichtiger Kritikpunkt Eribons an der Linken ist die Art und Weise, wie sie über die Arbeiterklasse spricht. Statt von Arbeiterinnen und Arbeitern, rede sie von »Geringverdienern« oder »sozial Schwachen«, statt von Ausbeutung und Widerstand, spreche sie von Reformen. Damit mache sie die Menschen zu passiven Opfern und Hilfsempfängern ohne kollektive Machtpotenziale. Braucht die Linke wieder mehr Klassenkampfrhetorik?
Es kommt darauf an, was mit Klassenkampfrhetorik gemeint ist. Möglichst oft »Arbeiterklasse« sagen, das wird wohl nicht weiterhelfen. Damit aus einer »Klasse an sich« eine politisch sich mobilisierende Klasse wird, braucht es aber natürlich Symbole und eine Sprache, die Würde, die Stolz und auch Stärke ausdrücken.
Einfaches persönliches Beispiel: Dass ich mich nie dafür geschämt habe Kind angelernter Arbeiter zu sein, hat damit zu tun, dass ich sehr früh zwei Dinge beigebracht bekommen habe. Erstens: Arbeiter machen alles, was man sehen kann. Ohne sie gibt es keine Häuser, gibt es keine Autos, gibt es nichts. Zweitens: Nach oben bückt man sich nicht. Das ist ein ganz rudimentäres Klassenethos und darin wurzelt auch Klassenstolz. Das gibt es alles auch heute noch, wenn auch verändert, wie ich aus meiner empirischen Forschungsarbeit weiß.
Wie kann DIE LINKE darauf aufbauen?
Eine intelligente Sprache, moderne Symbole und eine zuspitzende Kampagnenpolitik, die an dieses Klassenethos anknüpfen und es in der Öffentlichkeit sichtbar machen, wären sicherlich sehr wertvoll. Die Anziehungskraft, die die Kampagnen von Melénchon oder Corbyn entfaltet haben, deuten das an. Dabei klar zu machen, dass unser Gegner ein System ist, darin aber eine Ausbeuterklasse vom Elend anderer profitiert, schadet dabei sicher nicht. Genauso wichtig fände ich es aber – das wäre eine weitere Lehre aus den Beispielen von Bernie Sanders, Podemos oder Melénchon – dabei klar zu machen, dass wir ein grundlegend anderes Gesellschaftsmodell und ein neues politisches System brauchen, wenn wir eine Politik für die unteren Volksklassen wollen. Die LINKE müsste sich als Kraft der radikalen Demokratisierung verstehen, die für die Interessen der unteren Volksklassen kämpft.
Macht sie das nicht bereits?
Das nehme ich in der Öffentlichkeit zu wenig wahr, auch in Kampagnenzeiten – würde ich die inneren Diskussionen der Partei nicht kennen, dann würde ich meinen, sie wolle nicht etwas ganz Neues, sondern eine bessere Version vom Alten. Melénchons Forderung nach einer neuen Republik wirkt auf mich radikaler als unser Plädoyer für einen demokratischen Sozialismus, der eh nicht auf der Tagesordnung steht – und zu dem wir uns gemeinsam etwa mit SPD und Grünen auch nicht auf den Weg machen können.
Eribon hat er sich bei seinen Auftritten in Deutschland wiederholt für eine Regierungsbeteiligung der LINKEN ausgesprochen. Gleichzeitig kritisiert er, die Linke habe den Standpunkt der Regierten verlassen und einen Regierungsstandpunkt eingenommen. Ein Widerspruch?
In der Theorie nicht unbedingt. Eine rebellisch regierende LINKE könnte ja, gemeinsam mit Initiativen und Bewegungen, einiges durchsetzen – es ist aber etwas naiv anzunehmen, dass man mit SPD und Grünen rebellisch gegen Staatsbürokratien und Kapital regieren könnte. Die Causa Holm in Berlin hat – in Form eines Stürmchens im Wassergläschen, wenn man so will – ja angedeutet, was eine linke Reformregierung aushalten müsste. Nichts Neues würde passieren: Geballte Stimmungsmache durch die Medien, Kampagnen der Unternehmensverbände, eine sich mobilisierende Opposition und im Zweifelsfall auch wirtschaftliche Eingriffe durch das Banken- und Industriekapital. Das Hochjazzen von Rot-Rot-Grün kann ich auch daher nicht nachvollziehen, weil SPD und Grüne schneller auf ihren Knien wären, als wir »Jetzt müssen wir aber zusammenstehen« sagen könnten.
Woher kommen deiner Meinung nach die großen Hoffnungen auf Rot-Rot-Grün innerhalb der LINKEN?
Vielleicht ist es so, dass sich viele kluge Genossinnen und Genossen von der Macht der anderen und ihrer eigenen Ohnmacht etwas dumm machen lassen. Adorno hat ja gesagt, es sei eine fast unlösbare Aufgabe, das nicht zu tun. Er scheint recht zu behalten. Aber das ist gefährlich. Rot-Rot-Grün wäre nicht, wie es etwa das Institut Solidarische Moderne vor sich hinbetet, ein Mittel gegen die Rechte – es würde ihr den Weg bereiten, weil das Projekt sicher scheitern würde und sich ein Teil der Enttäuschten an die verbleibende reaktionäre Protestpartei wenden würde. Fällt die LINKE als Partei aus, an die Menschen ihre politischen Hoffnungen auf eine sozialere und demokratische Politik binden, dann gewinnt die AfD, die sich als Anti-Establishmentpartei gibt. Ich kenne natürlich die Stimmen, die sagen, dass wir die Menschen ebenfalls verlieren, wenn wir keine realistische Machtoption entwickeln. Das ist auch richtig. Nur halte ich eine Koalition mit der SPD und Grünen zwar für machbar, aber nicht für ein realistisches Mittel, um Umverteilung und Demokratisierung – um das Mindeste zu sagen – auf den Weg zu bringen.
Wie sieht die Alternative aus?
Wenn DIE LINKE Partei der arbeitenden Klassen sein will, dann reicht ihr größtenteils richtiges Programm nicht aus. Sie müsste eine starke Kraft der Organisierung von lokaler Gegenmacht werden: 60 Prozent Energie auf die Arbeit vor Ort, 20 Prozent interne Arbeit (insbesondere Bildungsarbeit, um die Mitglieder zu fördern), 20 Prozent auf die parlamentarische Arbeit. Ich muss wohl niemandem sagen, dass es eine innerparteiliche Kulturrevolution bräuchte, um zu einer solchen Arbeitsweise zu kommen. Aber wenn ich mal Revue passieren lasse, wie ich die Partei aus ein paar Kreisverbänden kenne, dann würde ich sagen: Selbst bescheidene 20 Prozent der Energie für mühevolle Organisierungsarbeit wären ein Fortschritt.
Aber es gibt doch auch Gegenbeispiele von dynamischen Basisgruppen und gelungener Bewegungsarbeit.
Ja sicher. Etwa im gewerkschaftlichen Bereich gibt es eine ganze Reihe wertvoller Erfahrungen mit Solidaritätsarbeit, die am Rande der Partei gesammelt wurden. Davon brauchen wir viel mehr. Wir sollten uns auch wieder an einer Politik mit Betriebsgruppen versuchen. Aber auch in Stadtteilen gibt es eigentlich genug zu tun. Ich denke etwa an Verkehrs- oder Mieterinnen- und Mieterinitiativen. Also an Möglichkeiten mangelt es nicht.
Wir sollten uns also fragen, wie wir gemeinsam ein politisches Instrument schaffen können, das denen, die ausgebeutet, unterdrückt und marginalisiert werden, in ihren Kämpfen nützt. Dazu müssen wir natürlich erstmal sagen, dass das nicht »die« sind, sondern »unsere Leute« – ich schätze, dann erkennen sie uns auch als »ihre Leute« an. Aber das heißt zunächst einmal, dass wir viel zuhören und uns beweisen müssen, um Vertrauen zu gewinnen.
Geht es darum auch in deinem neuen Buch »Ein unanständiges Angebot? Mit linkem Populismus gegen Eliten und Rechte«?
Ja, wir diskutieren zunächst einmal, weshalb die extreme Rechte erfolgreich ist, zeigen aber auch anhand empirischer Befunde der Lohnabhängigenbewusstseinforschung auf, dass es für eine populare sozialistische Bewegung erhebliche Anknüpfungspunkte im politischen Bewusstsein der Bevölkerung gibt.
Um zu beantworten, wie eine erfolgversprechende Linke vorgehen müsste, setzen wir uns dann unter anderem mit Sanders, Podemos, Chavéz aber auch Sahra Wagenknecht auseinander. Die Aufgabe, vor der wir stehen, lautet unseres Erachtens, dass wir aus den unteren Volksklassen, also aus der Arbeiterinnen- und Arbeiterklasse und den sich zu diesen nicht antagonistisch verhaltenden kleinbürgerlichen Schichten, einen neuen »Machtblock von unten« schaffen müssen, eine komplizierte Arbeit, die verschiedener Anstrengungen bedarf.
Wie könnten diese aussehen?
Besonders wichtig ist uns, dass ein popularer Sozialismus sich als Kraft konkreter Organisierungen in Bildungseinrichtungen, in Betrieben und Stadtteilen aufbauen müsste. Das reicht natürlich allein für sich genommen noch nicht aus, wir müssen auch unsere Organisationen und Parteien so reformieren, dass sie als Kräfte oder Instrumente derartiger Organisierungen nützlich sind; sollten daran arbeiten Mauern zwischen verschiedenen Teilen der Ausgebeuteten, Unterdrückten und Marginalisierten niederzureißen und Brücken zwischen ihnen zu bauen; und wir meinen, dass wir in diesem Zusammenhang auch mit populistischen Verdichtungen arbeiten sollten, um einen Antagonismus zwischen einer breiten popularen Bewegung auf der einen und dem Oben und seinen politischen Eliten auf der anderen Seite zu schaffen. Wir schreiben natürlich noch einiges mehr, etwa plädieren wir dafür demokratische Souveränität zu verteidigen, auch gegen die EU, und für rebellische Regierungsprojekte. Das kann ich hier aber wohl nicht mehr ausführen. Am besten man liest das Buch.
Die Fragen stellte Martin Haller für marx21.de