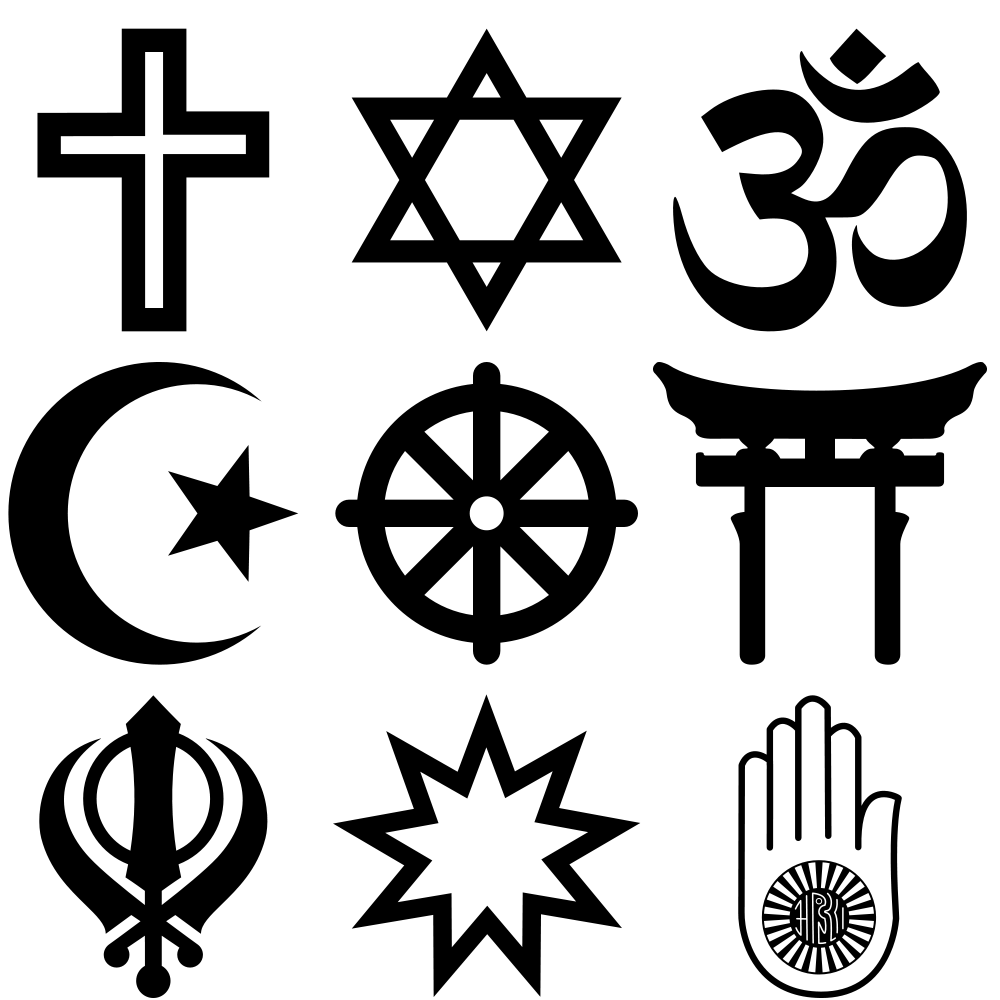Von der Weigerung, sich gegen den Rassismus meines Lehrers zu wehren, bis hin zur Weigerung, im Krieg gegen den Terror eine Rolle zu spielen.
In einer kalten Winternacht brachte meine Mutter meinen Bruder und mich in ein Krankenhaus auf der anderen Seite von Berlin. Es waren die ersten Monate der Zweiten Intifada, als die Mehrheit der demonstrierenden Palästinenser getötet oder verstümmelt wurde. Man sagte mir, Deutschland habe zwei palästinensische Jugendliche eingeflogen, die sofort ärztlich versorgt werden mussten.
Anmerkung der Redaktion: Dieser Aufsatz, der unter dem Titel „The Duty to See, the Yearning to be Seen“ („Die Pflicht hinzusehen, die Sehnsucht, gesehen zu werden“) veröffentlicht wurde, ist ein Auszug aus dem Buch „I Refuse to Condemn: Resisting Racism in Times of National Security” des Autors Tarek Younis, herausgegeben von Asim Qureshi und veröffentlicht bei Manchester University Press.
Wir betraten leise ihr Zimmer, um nicht den Frieden zu stören, der zwischen flackernden Lichtern und blassen, trockenen Mauern herrschte. Der ältere Jugendliche – vielleicht 18 Jahre alt, so alt wie mein Bruder – war wach, während der jüngere in einem separaten Raum schlief.
Ich erinnere mich an die Leere in dem Raum und fragte mich, ob außer meiner Mutter noch jemand von ihrem Aufenthalt wusste. Sie stand am Bett des älteren Jugendlichen und sie unterhielten sich. Mein Arabisch war auf ein gerade so passables Ägyptisch begrenzt, so dass ich nur Fragmente der in einem palästinensischen Dialekt erzählten Geschichte begriffen habe.
Deshalb übersetzte meine Mutter die Teile der Geschichte, dich ich nicht verstand. Der Junge im anderen Zimmer, so sagte sie mir, war mein Alter – 14 Jahre. Ihm war ins Bein geschossen worden.
Bevor sie ging, drückte meine Mutter einen Finger auf die Lippen und brachte uns in den anderen Raum, um dem schlafenden Kind beizuwohnen. Eine seltsame Ansammlung von Gips und Bandagen umschloss sein Bein. Ich erinnere mich, wie ich Gott dankte, dass er schlief.
Ich fragte mich, wie es sich anfühlte, angeschossen zu werden; warum jemand ein Kind erschießen wollte; wie schwer der Verlust eines Beins wirklich wog. Vor allem fragte ich mich, ob es sich lohnte, jemanden zu besuchen, der schlief, in einem leeren Raum, mit niemandem außer uns, der sich an das Ereignis erinnerte. Mir ist jetzt klar, dass genau das der Punkt war. Meine Mutter starb plötzlich, nicht lange nach diesem Krankenhausbesuch.

Meine Mutter lehrte mich, dass wir die Verantwortung haben hinzusehen, und dass sie im Gegensatz zu unserer Natur steht, gesehen zu werden. Wenn wir uns fragen, wie wir hierhergekommen sind, ist mir die düstere und blicklose Stille dieses Krankenhauszimmers immer eine wichtige Erinnerung gewesen.
In einem Buch über den Wert und die Ablehnung der Verurteilung wird sich meine Geschichte letztlich um die Angst drehen, als falsch, oder schlimmer noch, überhaupt nicht gesehen zu werden. Es ist also letztlich eine Geschichte der Feigheit, und ich schreibe sie für diejenigen, die wie ich Feiglinge sind. Wir dürfen nicht vergessen, dass man nur durch Angst lernt, mutig zu sein.
Der Schwerpunkt dieses Essays liegt also auf dem Sehen, dem Hinsehen. Ich schöpfe aus meinen Erfahrungen, wobei der Blick der anderen das Mittel und das Ziel meiner Bemühungen darstellt. Meine Geschichte wird in Abschnitten erzählt, wobei verschiedene Momente verschiedene Seiten einer Erfahrung enthüllen. Ich werde mich mit dieser schrecklichen Verbindung von Feigheit und Schweigen befassen, in der sich beide gegenseitig befruchten. Es ist eine Sache, nicht zu verurteilen, es ist eine andere zu wissen, dass mein Schweigen und die Furcht, „die Verurteilung zu verurteilen“, aus dem allgegenwärtigen Wunsch geboren wird, gesehen zu werden und dies zu bleiben.
Die Ehe von Feigheit und Schweigen
Meine Schule in Berlin war privilegiert durch ihre Demografie, die aus Weißen und der Mittelschicht bestand. Fast alle, die ich kannte, nahmen ihre Bildung ernst. Ich war der einzige Muslim in meinem Jahrgang.
Der Politikunterricht war kein Fach, der mir Spaß machte. Damals, Anfang der 2000er Jahre, war es eine endlose Darstellung der EU und ihrer Hegemonie, was bedeutete, das gefürchtete Potenzial eines Beitritts der Türkei herauszustellen. Es war offensichtlich, dass das die Auswahl meiner Lehrerin war. Sie schien in der „muslimischen Frage” stecken geblieben zu sein und hinterfragte stets den Platz der Muslime in der westlichen Gesellschaft.
Eines Tages, völlig aus heiterem Himmel, bat meine Politiklehrerin mich, nach dem Unterricht dazubleiben. Ich war mir nicht sicher, was mich erwartete: Ich bekam hin und wieder Schwierigkeiten, wenn ich irgendwo herumgeblödelt hatte, aber in ihrer Klasse war ich besonders ruhig. Ich wartete also, bis die Klasse leer war, dann kam sie ohne Vorwarnung auf mich zu und gab zu, dass sie Leute wie mich in ihrer Nachbarschaft nicht haben wollte.
Ich nickte gedankenlos, unsicher, ob dies unser Gespräch beenden oder ihr die Sicherheit geben würde, die sie offensichtlich suchte.
Ich erzählte die Erfahrung sofort meiner Englischlehrerin. Wir standen uns nahe, und ich wusste, dass sie den Ernst der Lage verstand. Wie erwartet wurde sie aufgebracht und lief davon, sicher erpicht darauf, in meinem Namen Vergeltung zu finden. Was auch immer sie fand, ich habe es nie gesehen.
Bis jetzt ist meine Geschichte nur eine Wiederholung jener Geschichte, die nach dem 11. September unzählige Male erzählt wurde. Doch schon bald danach wurde sie regelrecht weltfremd. Frustriert teilte ich meine Geschichte mit einem muslimischen Freund außerhalb der Schule. Wir sprachen selten miteinander, und wie es das Schicksal so wollte, erzählte er mir, dass sein Lehrer ihm kürzlich dasselbe gesagt hatte. Wir lachten über diese seltsamen geteilten Erfahrungen mit rassistischen Lehrern in ganz Berlin, und ich fand Trost in diesem kosmischen Zufall.
Dann gab mein Freund zu, dass er seinem Lehrer ins Gesicht geschlagen hatte.
Ich war verblüfft, unsicher über mich selbst. Ich war natürlich auch wütend auf meinen Lehrer, aber diese Emotion hatte nur sehr wenig ausgemacht. Es war mir peinlich, nicht weil ich Gewalt nicht als Option in Betracht gezogen hatte, sondern weil dieses schicksalhafte Telefongespräch zu einer harten Enthüllung geführt hatte: Ich schlage vielleicht nicht zu, aber ich lernte, dass es die Angst war, nicht die guten Manieren, die mich vor einem Konflikt bewahrten.
Ich fühlte mich plötzlich zu einem Gespräch mit einer alternativen Version von „Ich“ gezwungen, deren Dimension sich im Moment der Verletzung spaltete. Ein Ich, das sich nicht so schnell der Unterdrückung beugte, so unklug und unethisch die Faust auch sein mochte. Ein Ich, das den Mut und die Kreativität hatte, Vergeltung zu finden, jenseits der mageren Wahlmöglichkeiten, die vor mir lagen.
Mein Freund hat sicherlich mein Unbehagen zur Kenntnis genommen und das Schweigen gefüllt. Meine Lehrerin war eine Frau, scherzte er, und schließlich war es nur richtig, Männer zu schlagen. Ich sagte ihm nicht, dass alles, was ich über Wut wusste, jedes Vertrauen, das ich hatte, darin bestand, sie in mir drinnen einzusperren; vielleicht einen Teil davon willkürlich auf einen Englischlehrer abzuwälzen, wovon ich wusste, dass es auf nichts hinauslaufen würde. Ich sagte ihm nicht, dass ich mir nicht einmal das Herz fasste, meinem Lehrer zu widersprechen. Ich habe ihm nicht gesagt, dass ich gerade herausgefunden habe, dass ich ein Feigling bin.
Ich wollte gesehen werden, aber ich fürchtete den unwillkommenen, abweisenden Blick, der in Konfliktmomenten so ausgeprägt ist. So blieb ich für den Rest der zwei Jahre, die ich mit dieser Politiklehrerin verbrachte, katatonisch. Bis dahin hatte ich das Gesicht meiner Mutter vergessen. Sie hätte mich daran erinnert, dass die Blicke der Anderen nur wenig zählten.
Am Ende zog der Politikkurs meine Noten nach unten. Trotz der Versuche, dies in anderen Klassen auszugleichen, sorgte mein abschließender Notendurchschnitt dafür, dass ich an keiner Berliner Universität in mein Wunschprogramm aufgenommen werden konnte.
Außerhalb des Gut-Seins
Die Frage, warum es schwierig ist, sich der Verurteilung zu verweigern, verfehlt den Wald vor lauter Bäumen. In mir wurde eher die Frage auf den Kopf gestellt: Warum ist die Zustimmung der anderen so verlockend? Für die Muslime im globalen Norden ist der Wunsch, den Terror zu verurteilen, zwar verlockend, aber er ist nur Ausdruck des Wunsches, gesehen zu werden.
Der Krieg gegen den Terror bedarf keiner einleitenden Worte, doch insofern er einen dynamischen Prozess widerspiegelt – fließend, nicht greifbar – muss ich kurz ausführen. Der Krieg gegen den Terror steht am Schnittpunkt zweier der größten Ideologien unserer Zeit: des Kapitalismus und des globalen militärisch-industriellen Komplexes einerseits und des Nationalismus und des Managements der Zugehörigkeit andererseits. In diesem Kapitel bezeichne ich beide Ideologien zusammengenommen durchgehend als „Macht“ („Power“ im Original).
Natürlich haben Muslime eine besondere Beziehung zum Krieg gegen den Terror. Auf der einen Seite ist die Behinderung des unerbittlichen Marsches der Kriegsindustrie gegen das Böse gleichbedeutend damit, außerhalb des Guten selbst zu stehen. Sich dem Krieg zu stellen und sich ihm zu widersetzen, bedeutet, das Gefühl vermittelt zu bekommen, auf der Seite des Terrors zu stehen. Auf der anderen Seite bedeutet es, außerhalb der Grenzen des „gemeinen Volkes“ zu stehen, wenn man die Nation nicht, wie sie, erhöht. Sich gegen den Nationalstaat zu stellen, bedeutet, alle Vorurteile wahr werden zu lassen – dass du in Wirklichkeit eben doch nicht dazugehörst. In beiden Ideologien hat es immense Vorteile, von der Macht gesehen zu werden (im Sinne von akzeptiert zu werden) – materiell und seelisch.
Der „gute“ Muslim werden
Nach der High-School zog ich nach Montreal und ließ alle Entdeckungen, die ich über mich selbst oder die Macht gemacht hatte, hinter mir und entfernte mich weiter von der Weisheit meiner Mutter. Ich blieb dennoch geneigt, Gutes zu tun, und sah mich selbst als „muslimischen Aktivisten“. Doch der Wunsch, gesehen zu werden, ist selbst in den prinzipientreuesten Absichten vorhanden.
Ich engagierte mich voller Engagement sowohl in Gemeinschaftsaktivitäten – insbesondere im Zusammenhang mit der muslimischen Jugend, was mich auf den Pfad der klinischen Psychologie führte – als auch im politischen Aktivismus, sowohl auf nationaler als auch auf internationaler Ebene. Ich trenne hier den Muslim und die Politik, weil dies natürlich die Narrative der „guten“ Muslime sind. Ich erinnere mich noch gut an den Gegenwind, der mir als Präsident der Muslimischen Studentenvereinigung entgegenblies, als ich vorschlug, dass wir uns an die Spitze einer Bewegung für die Rechte der Palästinenser stellen sollten – „die MSA ist unpolitisch“, wurde mir gesagt.
Die Aufmerksamkeit, die mir als muslimischer männlicher Psychologe zuteilwurde, sowohl von Muslimen als auch von der Macht, war enorm. Die westliche Psychologie ist ein besonderes Artefakt der Macht – eine Art säkulare Theologie – und die muslimische Repräsentation in ihr ist sehr begehrt. Mein Hintergrund und meine Erfahrung in der Arbeit mit der muslimischen Gemeinschaft, insbesondere mit Jugendgruppen, überschnitten sich plötzlich auf unglaubliche Weise mit dem Wunsch der Macht, das Leid, das sie verursacht, durch „Beruhigung von innen“ zu befrieden.
Die Macht schafft für alle immer lukrative Möglichkeiten, ihre Gnade zu erlangen, solange sie nur nach ihren Regeln spielen, und ich war auf dem besten Weg ein Psychologe zu werden, der seine Rolle kannte und zu spielen verstand. Repräsentation ist der Schlüssel in diesem Prozess der Befriedung, und wer könnte das besser vertreten als ein muslimischer Psychologe, der das Ideal säkularer Unantastbarkeit (Fachleute für psychische Gesundheit als säkulare Seelenpriester) und Diversitätspolitik darstellt?
In wenigen Jahren wurde ich, wie andere, die sowohl mit Gelegenheiten als auch mit Privilegien gesegnet waren, plötzlich eingeladen, über klinische und soziale Fragen westlicher Muslime zu beraten. Glücklicherweise hatte ich unglaublich scharfsinnige Mentoren, die mir so viel Orientierung und kritische Literatur bereitstellten, wie ich verdauen konnte (insbesondere die Frage nach dem Verhältnis der Psychologie zur Macht). Und doch blieb ich selbst nach all diesen kritischen Überlegungen immer noch von dieser uralten Maxime der Macht überzeugt: „Wenn du etwas ändern willst, dann schließe dich uns an und ändere es von innen heraus.”
Bald begann ich im Rahmen eines Sonderausschusses, der sich mit muslimisch-arabischen Anliegen befasste, die Polizei von Montreal zu beraten. Es war nicht unüblich, bei diesen Treffen Fragen im Zusammenhang mit Terrorismus und Radikalisierung zu erörtern. Als diese aufkamen, blieben die Narrative statisch: Ja, es gibt „böse Muslime“ da draußen, aber es gibt die „guten Muslime“ (vor allem in diesem Raum), die vorbildliche Bürger waren.
Unsere Modellhaftigkeit, unsere bloße Anwesenheit, war die physische Manifestation der Verurteilung. Ich hatte bei diesem Gedanken meine Bedenken, obwohl ich gelernt habe, meine Befürchtungen zu anderen Zeiten geltend zu machen (und dabei versagt habe). Vor allem aber lernte ich, dass Schweigen eine Handlung mit einer ureigenen unkalkulierbaren Belohnung war. Diese Gabe zeigte sich bei der amerikanisch-kanadischen Grenzkontrolle.
Das Privileg der Güte
Mein Cousin und ich planten eine Autoreise nach New York. Er war ein Footballspieler, der fürs Trainieren auch reist, in die Türkei etwa. Natürlich wurden wir aufgehalten, als wir die Nordgrenze überquerten. Als die Stunden vergingen, scherzten mein Cousin und ich, wie der Offizier seine Informationen unter der Seite „Sport“ überprüfte – sicherlich ist „reist zum Football in die Türkei“ als verdächtig gekennzeichnet.
Doch dann gab der Offizier die Dokumente meines Cousins zurück, und es stellte sich heraus, dass ich es die ganze Zeit war. Ich war der Grund dafür, dass wir aufgehalten wurden.

Nach Anbruch der zweiten Stunde begann ich, nach dem Grund dafür zu fragen, weshalb wir aufgehalten wurden. Der Beamte gab keine Erklärung ab. Er sagte, er müsse noch das System überprüfen.
„Glauben Sie, dass jemand, der die Polizei von Montreal berät, ein Problem darstellen würde?“, fragte ich frustriert.
Der Agent sah von seinem Monitor auf: „Beweisen Sie es.“
Zufälligerweise hatte ich aber genau den Beweis: ein Empfehlungsschreiben von einem der stellvertretenden Direktoren der Polizei von Montreal auf meinem Telefon. Ich zeigte es dem Agenten. Er nahm das Telefon in die Hand, starrte es einen Moment lang an und gab es zurück.
„Das sollten Sie jedes Mal bei sich tragen, wenn Sie die Grenze überqueren“, sagte er. Er gab uns alle Papiere zurück, und wir fuhren los.
Mein Cousin und ich lachten, als wir in die Catskill Mountains fuhren. Doch ich schämte mich: So haben mich meine Eltern nicht erzogen. Was ist mit denen, die nie irgendeinen Brief haben? Wie geht es denen ohne Privilegien?
Bis heute erhalte ich ständig Angebote, den Krieg gegen den Terror in der einen oder anderen Form zu unterstützen. Ich bin ein muslimischer, männlicher, klinischer Psychologe, der sich auf die kulturellen und politischen Dimensionen der psychischen Gesundheit spezialisiert hat. Ich habe einen breiten Hintergrund in der Arbeit mit gefährdeten Jugendlichen innerhalb der muslimischen Gemeinschaft und sozialen Fragen im weiteren Sinne. Ich habe einen Forschungshintergrund in Islamophobie und bürgerschaftlichem Engagement. All dies sind höchst wünschenswerte Qualitäten für die Macht, insbesondere angesichts der Zahl der Muslime, die sich allein aufgrund ihrer religiösen Identität der Terrorismusbekämpfung anschließen.
Aber ich würde meinen Doktor lieber verwerfen, als mich am Krieg gegen den Terror zu beteiligen.
Nous Sommes Quebecois!
Im Jahr 2017 drang ein Schütze in eine Moschee in Quebec City ein und schoss beim Nachtgebet in die Reihen auf 53 Menschen, wobei sechs Menschen getötet und weitere 19 verletzt wurden.
Über 2.000 Menschen füllten die Hallen des Montrealer Olympiastadions, in denen das Begräbnisgebet stattfand. Ich wurde gebeten, neben anderen eine kurze Rede zu halten. Zunächst schrieb ich eine für die Muslime im Publikum. In der Rede wurde ich Zeuge des Zorns, den viele gegenüber dem politischen Establishment in Quebec empfanden und der die Vorurteile des Mörders lange Zeit legitimierte. Einige der Politiker waren an diesem Tag anwesend.
Aber ich habe diese Rede nie gehalten. Ich habe mich aus Feigheit zurückgehalten. Stattdessen gab ich die übliche Erklärung ab, „das Unglück gemeinsam überwinden“, und im Gegenzug – wie verspottet von meiner eigenen Rückgratlosigkeit – bebte das Stadion unter Sprechgesängen: Wir sind Quebecer! Nous sommes Quebecois!
Was genau war es in diesem schrecklichen Moment, das uns alle dazu brachte, den Blick auf uns selbst zu richten, auf unsere Nationalitäten, nicht weniger? Für mich ist es der Anblick der Toten, der eine unerträgliche Reaktion auslöste: Sie anzusehen, wirkliches Zeugnis der Umstände ihres Todes abzulegen, hätte eine Wut auf die Macht ausgelöst, die die Gedanken des Mörders über Muslime legitimiert hätte. Diese Wut aber lässt uns in einem schlechten Licht erscheinen. Stattdessen flehen wir um den fortgesetzten Blick der Macht auf uns und verlangen noch mehr ihres guten Lichtes.
„Wir sind Quebecer! Könnt ihr uns nicht sehen?“
Hier hat das mächtige und unsichere „Werdet nicht wütend!“, das Ralph Ellisons Protagonist den Schaulustigen der Vertreibung eines älteren Schwarzen Paares in Invisible Man zurief, bei mir einen starken Widerhall gefunden. Man darf natürlich nicht wütend werden, denn die Erfahrung von Wut, auch wenn sie noch so redlich ist, kann außerhalb des Blicks der Macht nicht existieren. Die Weigerung zu verurteilen, ist also eine Weigerung, vollständig im Blicke der Macht zu existieren.
Der Angriff auf die Moschee von Quebec hat uns für einen kurzen Moment den Blick der Macht bewusst gemacht. Doch dann vergessen wir den Blick schnell und kehren zum Leben in ihm zurück, da er die Parameter unserer Erfahrung definiert. „Werdet nicht wütend!“
Ich habe fälschlicherweise geglaubt, unsere Erlösung bestünde darin, dass wir gesehen werden – wenn es doch eigentlich unsere Aufgabe ist hinzusehen. Wenn wir jemandem in Not zu essen geben, sollten wir die Kameras und die Verkündigung „Dies ist der wahre Islam“ scheuen – und dann trotzdem weiteres Essen geben. So schrecklich dieses Schweigen auch sein mag, so anstrengend unsere Ablehnung der Kameras auch sein wird, wir müssen lernen, unseren Frieden darin zu finden, die Anerkennung der Macht von uns weisen.
Man kann behaupten, im Verborgenen zu handeln, oder nur von Gott oder einer bestimmten Gruppe („die Unterdrückten“) gesehen zu werden. Doch insofern der Blick der Macht all unsere Handlungen umspannt, muss auch unsere Verweigerung ein aktiver Prozess sein.
Anders ausgedrückt: Für jede öffentliche Handlung, die von Muslimen vor den Augen anderer begangen wird, muss es einen gleich starken Impuls geben, sich dagegen zu wehren, dass diese Handlung von kapitalistischen oder nationalistischen Ideologien, die alle in der Binarität „guter Muslim/böser Muslim“ gefangen sind, vereinnahmt wird.
Wir müssen erkennen, dass es die Leistung des Sehens und nicht der Status des Gesehenwerdens ist, der uns verbindet. Doch für jeden, der dies liest und wie ich ein Feigling ist, wird es nicht leicht sein. Denn die größte Götze wird stets die Sehnsucht des Selbst sein, gesehen zu werden.
Sich weigern zu verurteilen, sich widersetzen, gesehen zu werden.

Meine Mutter lehrte mich, dass wir weit von den rationalen Geschöpfen entfernt sind, für die wir uns halten, und dass ein Laib Brot zwei Menschen einander näherbringt als alle Philosophien der Welt zusammen. Sie lehrte mich, dass Gemeinschaft kein intellektuelles, sondern ein performatives Konstrukt ist.
Die Weigerung zu verurteilen bedeutet nicht einfach, das Etikett „guter Muslim“ abzulehnen – sie ist allen voran das Widersetzen unserer Sehnsucht, von der Macht gesehen zu werden. Die Weigerung zu verurteilen, bedeutet also, sich der Angst zu stellen, zu unseren eigenen Bedingungen zu mobilisieren. Es gibt keine Tapferkeit ohne Feigheit, keine Stärke ohne Verletzlichkeit, keine Weisheit ohne Ignoranz. Insofern die beiden Triebe der Welt am stärksten sind – Kapitalismus und Nationalismus also – werden unsere Absichten immer zwischen unserem Wunsch, Gott und der Macht zu gefallen, hin- und herflackern.
Ein konkretes Beispiel, das die Kernthese dieses Texts illustriert, ist hier dokumentiert. Der Autor dieses Textes wurde auf Twitter vom deutschen Politikwissenschaftler Peter Neumann unter Einschaltung seines Arbeitgebers bedrängt, einen Terrorangriff in Frankreich zu verurteilen.
Dieser Artikel von Tarek Younis erschien zuerst auf Middle East Eye und wurde von Manuel Bühlmaier für Die Freiheitsliebe übersetzt.
Subscribe to our newsletter!
The shortcode is missing a valid Donation Form ID attribute.