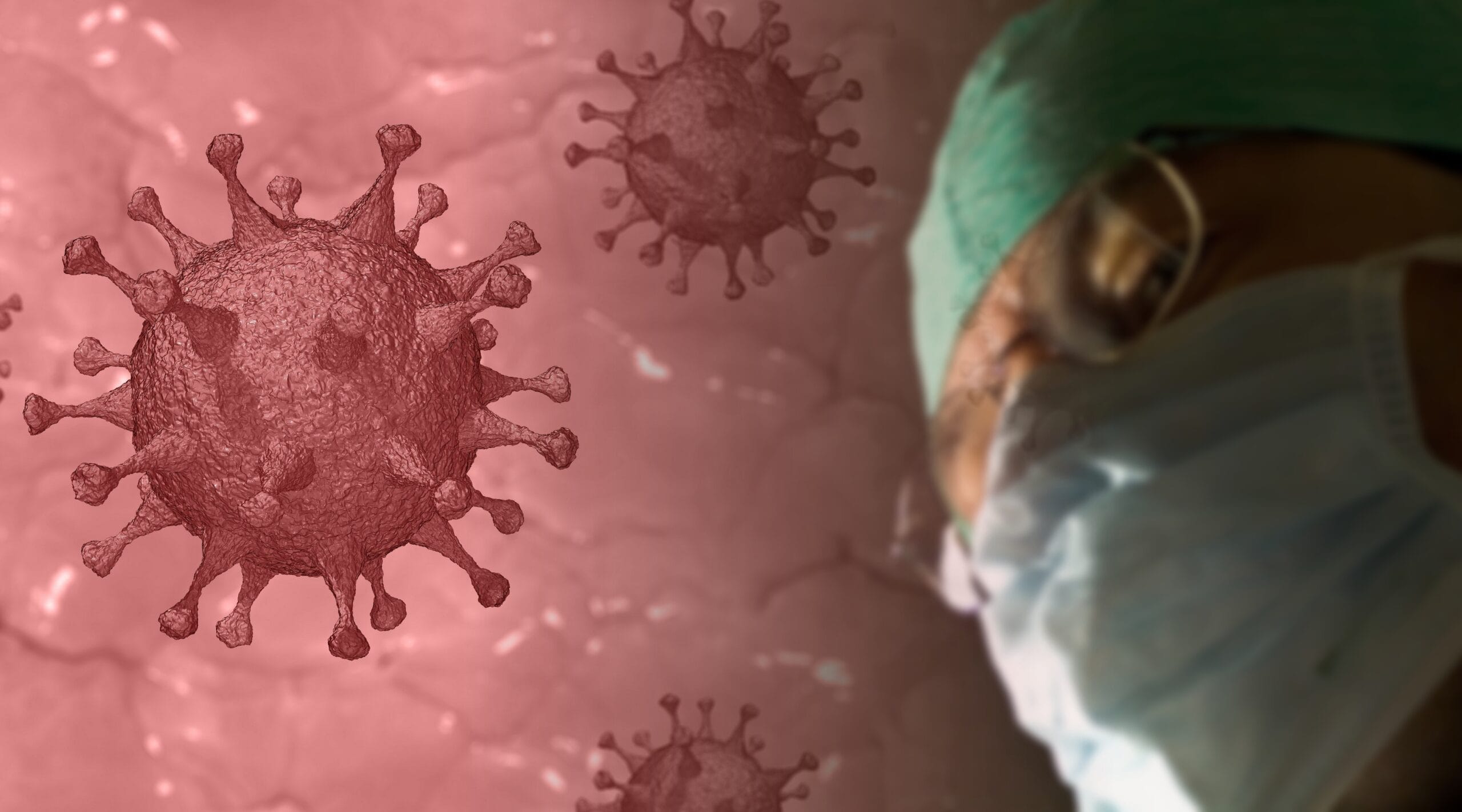Wie viele frühere Wirtschaftskrisen so wird auch die gegenwärtige Krise mit einer speziellen Bezeichnung in die Geschichtsschreibung eingehen; sie wird wohl als Corona-Krise bezeichnet werden. Falsch wäre das nicht, denn der von dieser Pandemie und ihrer Bekämpfung mittels lockdown ausgelöste Wirtschaftseinbruch wird ziemlich sicher – genau berechnen lässt sich das freilich kaum – stärker ausfallen, als die anstehende „normale“ Krise ausgefallen wäre.
Andererseits wird mit einer solchen Bezeichnung auch suggeriert, dass die gegenwärtige Wirtschaftskrise allein auf einen außerhalb ökonomischer Zusammenhänge entstandenen Schock – ein Virus, das von Wildtieren auf Menschen übertragen wurde – zurückzuführen sei. Die von der gegenwärtigen Pandemie verursachte besondere Tiefe des Einbruchs der Weltwirtschaft wird viele Kommentatoren und Ökonomen damit vergessen lassen, dass alle Zutaten sowohl einer zyklischen wie einer Finanzkrise längst vorhanden waren. Das produzierende Gewerbe kämpft schon seit gut zwei Jahren mit rückläufiger Produktion und sank bis Ende des vorigen Jahres auf das Niveau von 2015. Der lange, nur 2012 kurz unterbrochene Aufschwung hatte zu beträchtlichen Überkapazitäten geführt. Während der private und staatliche Konsum in Deutschland seit 2010 – dem ersten Jahr des langen Aufschwungs – bis 2019 um 26 Prozent stieg, sind die Bruttoanlageinvestitionen um fast 50 Prozent gewachsen. So kann es nicht Wunder nehmen, wenn die Kapazitätsauslastung infolge des schwächeren Wachstums der Nachfrage schließlich zurückging und die Produktion eingeschränkt wurde.
Die Bezeichnung als Corona-Krise lässt leicht auch vergessen, dass der Preisboom im Immobiliensektor zu einem Aufschwung im Bausektor führen musste, der mit dem Platzen der Blase auch diesen in die Krise getrieben hätte. Der Auftragseingang für die Industrie – ein Indikator, der auf die zu erwartende Produktion verweist – zeigte trotz einer leichten Erholung gegen Ende vorigen Jahres zwei Jahre lange nach unten. Durch die Wortwahl rückt auch in den Hintergrund, dass sich die Finanzmärkte in eine Phase der Labilität und Überspanntheit hineingesteigert hatten, die nicht wenigen Finanzexperten schon lange vor Corona die Sorgenfalten auf die Stirn getrieben und ein Platzen der Finanzblase im Jahr 2020 immer wahrscheinlicher gemacht hatten. Außer auf diese systemischen Ursachen war auch immer wieder auf politische Risiken wie den Brexit oder den Handelsstreit zwischen den USA und dem Rest der Welt verwiesen worden.
Dass es so lange keine Krise gab, hatte seine Ursache unter anderem im wachsenden wirtschaftlichen Einfluss Chinas. Es nutzte seine wirtschaftspolitischen Instrumente einer gemischten Wirtschaft zur Verstetigung seiner Konjunktur und wirkt mit einem Anteil von knapp 20 Prozent am kaufkraftbereinigten globalen Bruttoinlandsprodukt stabilisierend auf die Weltwirtschaft ein. Ohne seine chinesischen Absatzmärkte könnte die deutsche Industrie beispielsweise kaum mehr profitabel wirtschaften. Zum anderen hat die expansive Geldpolitik nahezu aller Zentralbanken dazu beigetragen, den Ausbruch einer Krise hinauszuzögern. Mit dieser Geldpolitik wurden zwar die systemischen Ursachen zyklischer und finanzmarktbedingter Einbrüche nur zeitlich verschoben, aber das ging offensichtlich ziemlich lange gut. Der Krug geht so lang zum Brunnen, bis er bricht – aber auch das braucht eben seine Zeit.
All das wird von den wirtschaftlichen Folgen der Pandemie jetzt weit, weit in den Schatten gestellt. Die Angebotsseite, also die Produktion, wird in Mitleidenschaft gezogen, weil Betriebe heruntergefahren oder geschlossen und Lieferketten unterbrochen werden. Damit implodieren auch die produktive wie die konsumtive Seite der Nachfrage. Beide Effekte treffen Deutschland mit seiner stark in die weltwirtschaftliche Arbeitsteilung integrierten Wirtschaft besonders hart. In den Medien wurde noch vor einer Woche vor allem auf den Einbruch der Börsenkurse verwiesen, der in der Tat dramatisch ist und dessen Falltiefe in so kurzer Zeit nur wenige historische Vorbilder hat.
Erstmal weniger im Fokus standen solche Größen wie Produktion und Auftragseingang auch, weil verlässliche Zahlen dafür erst ein bis zwei Monate später zur Verfügung stehen. Inzwischen hat sich das geändert und die Forschungsinstitute stellen erste, ziemlich besorgniserregende Überlegungen dazu an. Der vergangene Woche veröffentlichte Ifo-Geschäftsklimaindex, der auf der zeitnahen Befragung mehrerer Tausend Unternehmen beruht, verzeichnete den stärksten Rückgang seit 1991 und hat den niedrigsten Wert seit August 2009. In China liegen die einschlägigen Wirtschaftszahlen seit Jahresbeginn allesamt im zweistelligen Minus; es ist offen, wie stark die gegenwärtige Erholung sein wird und ob die deutsche Exportwirtschaft davon partizipiert. Der von der Pandemie verursachte Wirtschaftseinbruch besorgt auf diese Weise die Funktion der zyklischen und Finanzmarktkrise gleich mit. Überakkumuliertes Kapital sowohl im produktiven wie im Finanzbereich wird in Größenordnungen zerstört und entwertet. Die ins Gigantische gewachsenen Vermögenswerte werden abgeschmolzen und die Hochvermögenden werden ihre Verluste lauthals beklagen. Es wird ein Jammern auf hohem Niveau sein, denn was bedeutet es schon für deren Lebenslage, wenn der nominelle Wert ihres Geldvermögens von zehn Millionen auf fünf Millionen abstürzt? Härter trifft es die Schwachen in dieser Gesellschaft, die über gar kein Vermögen und nur unterdurchschnittliche Einkommen verfügen. Der Einschnitt von einem verfügbaren Monatseinkommen von, sagen wir, 1.000 Euro über das Arbeitslosengeld von 60 oder 67 Prozent auf den neuen Hartz-IV-Regelsatz von 432 Euro ist da weit größer – er ist existenziell. Da reden wir noch gar nicht über die Gewinner der Krise wie zum Beispiel die Medizinindustrie oder Spekulanten wie Ray Dalio, Gründer des weltweit größten Hedgefonds Bridgewater, der drei Milliarden Dollar auf fallende Dax-Werte setzte und massive Gewinne eingefahren hat.
Das Zusammentreffen dieser drei Krisen, der zyklischen, der Finanz- und der pandemischen Krise, offenbart in eklatanter Weise neben ihrer sozialen Asymmetrien die systemischen Schwächen und Defizite der heutigen Wirtschaftsordnung. Den auf Profit und shareholder value getrimmten Unternehmen ist eine resiliente, an Bürgerinteressen orientierte Struktur der Wirtschaft egal. Produziert wird dort, wo Kapitaleinsatz und Kosten am niedrigsten und die Gewinne am höchsten sind. Mit Monopolisierung und Globalisierung werden zwar Profite maximiert, die Lieferketten werden aber auch länger und störanfälliger. Auch im Gesundheitswesen, egal ob privat oder öffentlich, wurde auf Teufel komm raus gespart und an der Obergrenze der Kapazitäten gefahren, was zulasten der Möglichkeit einer flexiblen Reaktion auf Katastrophenfälle geht. Eine von der Bertelsmann-Stiftung in Auftrag gegeben Studie empfahl voriges Jahr sogar, die landesweite Zahl der Kliniken von 1.400 auf weniger als 600 mehr als zu halbieren. Man fragt sich, welchen Prämissen manche „Experten“ eigentlich folgen und wo sie überhaupt leben.
Wieder einmal paukt die Wirklichkeit dem Publikum ein, wie kurzsichtig und fehlorientierend die Formel „Mehr Markt, weniger Staat“ ist. Da ist es fast schon ein Lichtblick, wenn die Regierung den Empfehlungen der Virologen, wenn auch zögerlich, folgt und auch die Schuldenbremse nach Artikel 109/115 Grundgesetz auszureizen beabsichtigt: „Im Falle von Naturkatastrophen oder außergewöhnlichen Notsituationen, die sich der Kontrolle des Staates entziehen und die staatliche Finanzlage erheblich beeinträchtigen, können diese Kreditobergrenzen auf Grund eines Beschlusses der Mehrheit der Mitglieder des Bundestages überschritten werden. Der Beschluss ist mit einem Tilgungsplan zu verbinden. Die Rückführung der nach Satz 6 aufgenommenen Kredite hat binnen eines angemessenen Zeitraumes zu erfolgen.“ Die Schuldenbremse ist also keineswegs ausgesetzt, wie häufig zu lesen ist, ausgesetzt ist lediglich die „schwarze Null“, jene fragwürdige Übertreibung in der Auslegung der Artikel 109/115. Wie weit der 600-Milliarden-Euro schwere „Wirtschaftsstabilisierungsfonds“ der Bundesregierung und die 750-Milliarden-Euro-Anleihekäufe der Europäischen Zentralbank (Letztere betreffen natürlich den Euro-Raum insgesamt) den freien Fall der Wirtschaft abzufedern vermögen, bleibt abzuwarten. Die Vorzeichen jedenfalls stehen nicht so, dass dieser Fall schwächer als 2009 ausfällt. Die durchaus beachtlichen Konjunkturstützungsprogramme von EZB und Bundesregierung haben damals den Absturz zwar abgebremst, das reale BIP schrumpfte trotzdem um 5,1 Prozent.
Dieser Beitrag von Jürgen Leibinger ist eine Übernahme aus der soeben erschienenen neuesten Ausgabe von „Das Blättchen – Zweiwochenschrift für Politik, Kunst und Wirtschaft“. Die komplette Ausgabe kann auf der Website www.das-blaettchen.de kostenfrei eingesehen werden. Allerdings haben auch nicht-kommerzielle Projekte Kosten. Daher helfen Soli-Abos zum Bezug als PDF (hier klicken) oder in einem eBook-Format (hier klicken) dem Redaktionsteam bei der Lösung dieser Frage.