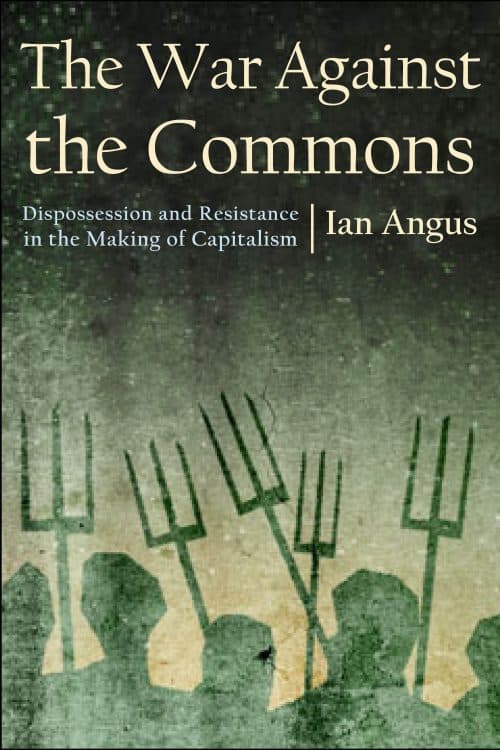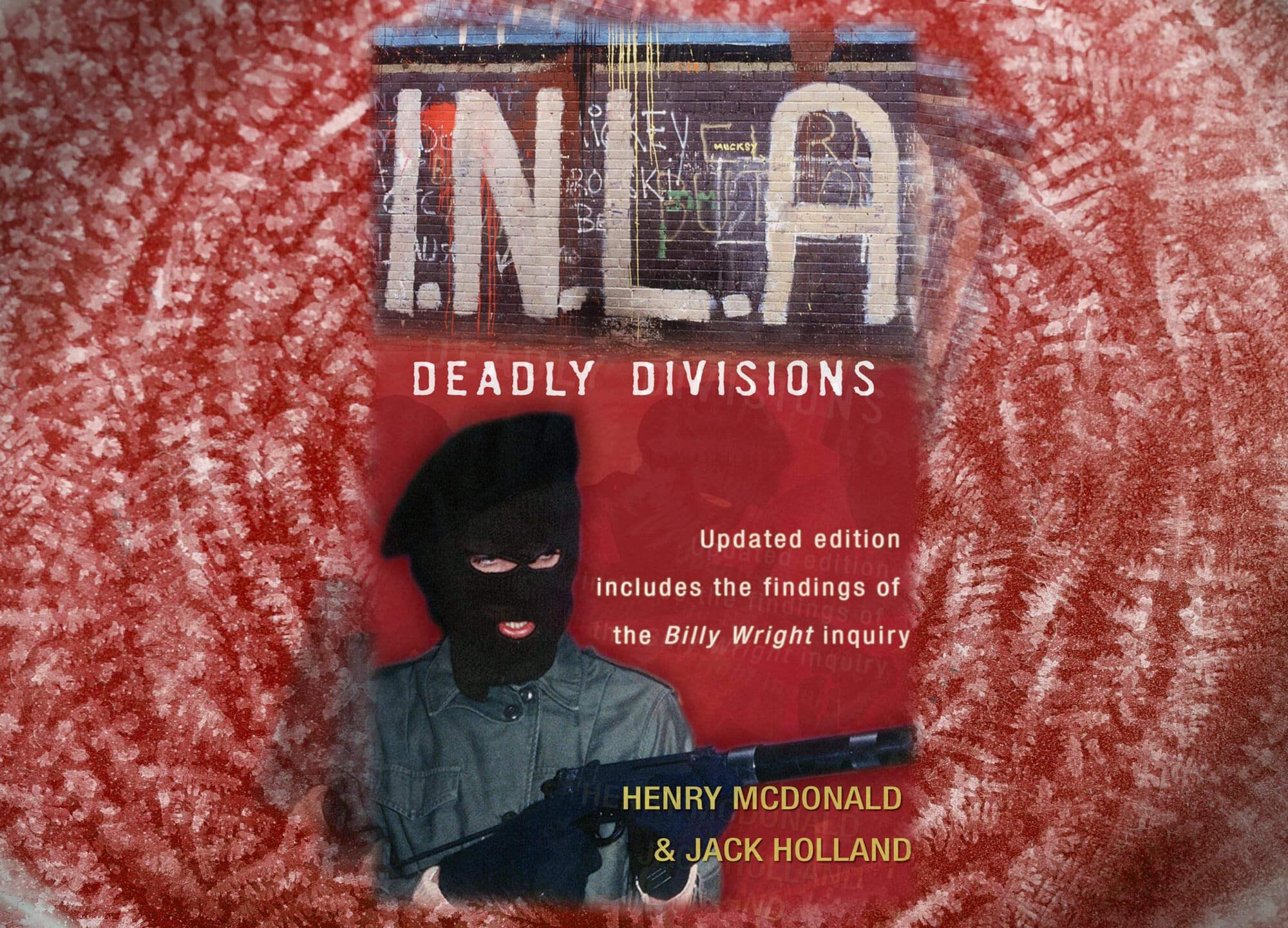Es gibt erbärmliche Bemühungen, Stimmung gegen „Wokeness“ zu schüren. Rechte Zeitungen mit Massenauflagen beschweren sich, dass ihre Lügen und Vorurteile in Gefahr sind, „gecancelt“ zu werden. Das Eintreten gegen Rassismus wird als „Tugendhaftigkeit“ lächerlich gemacht. Dies sind Beispiele dafür, dass die britischen Tories versuchen, die seit langem etablierten Methoden der US-Republikaner und ihrer medialen Verbündeten bei FOX News und Talk-Radiosendern zu importieren. Und der Mann, der dafür die größte Verantwortung trägt, ist Premierminister Boris Johnson.
In der Tat hat Johnson seit vielen Jahren versucht, die „Kulturkriege“ der republikanischen US-Parteirechten nach Großbritannien zu bringen. Er versuchte es zum ersten Mal, als er 1999 Herausgeber der Zeitschrift The Spectator wurde. Hierfür gibt es zwei Gründe. Der erste ist, dass Johnson völlig uninteressiert an Politik ist, nicht die Geduld hat, sich mit Details zu befassen, und sie auch nicht für wirklich wichtig hält. Andere Leute denken sich die Politik aus und sein Beitrag darin besteht, sie in seine Sprache zu übersetzen.
Für Johnson ging es in der Politik immer um Rhetorik, um Getöse, und nicht um Details. Das hat ihn zum perfekten Frontmann für die Tories gemacht – erst als Bürgermeister von London und jetzt als Premierminister. Unter diesem Gesichtspunkt ist die Kulturkampfstrategie für Johnson offensichtlich attraktiv. Das Schüren von Vorurteilen und Spaltung ist etwas, das er während seiner Jahre als Journalist beim Daily Telegraph gelernt hat.
Der zweite Grund ist, dass sich Labour unter Tony Blair und Gordon Brown mit ihrer Hinwendung zum Thatcherismus weit nach rechts bewegt hat. Sie setzten sich für die Privatisierung ein, weigerten sich, Margaret Thatchers gewerkschaftsfeindliche Gesetze aufzuheben und kuschelten mit dem Großkapital und den Superreichen. Johnson und sein Kreis beim Spectator beschlossen, dass sie ohne nennenswerte Unterschiede in der Wirtschaftspolitik auf dem Terrain der kulturellen Auseinandersetzungen stehen und kämpfen müssten. Johnson selbst machte dies deutlich, als er sich darüber beschwerte, dass Blair versuchte, Thatcher zu imitieren, obwohl er darauf bestand, dass Blair immer der gewisse „Scharfsinn“ von Thatcher fehlte.
Stattdessen blickte Johnson auf die USA, wo der rechte Flügel der Republikanischen Partei seit den 1970er Jahren Unterstützung für so genannte „kulturelle Themen“ mobilisiert hatte. Diese kulturellen Themen lassen sich am besten unter dem Schlagwort rechter Identitätspolitik zusammenfassen. Die Strategie beruht auf dem Versuch, Klassenunterschiede zu überwinden, indem sie den Widerstand gegen Themen wie das Recht der Frau auf Wahlfreiheit, Bürgerrechte oder Einwanderung schüren. Dies hilft ihnen, normale Menschen hinter einer unternehmerischen, gegen die Arbeiter*innenklasse gerichteten Agenda zu vereinen.
Ein Problem für Johnson war die Rolle, die das evangelikale Christentum in diesem Bestreben in den USA spielte und immer noch spielt. Er war zum Beispiel völlig abgeneigt davon, wie die Republikaner den damaligen Präsidenten Bill Clinton wegen seiner Affäre mit Monica Lewinsky in den späten 1990er Jahren verfolgten. In der Tat zeigte die Affäre laut Johnson, welch „erstaunliche Organisationskraft“ Clinton besaß, da er „in der Lage war, die freie Welt zu führen, (…) während er gleichzeitig einen Seitensprung hatte“.
Ebenso war er in den 2000er Jahren nicht einverstanden mit Präsident George W. Bushs „sozial konservativen Schritten, (…) die den britischen Tories wahrscheinlich nicht genehm und trotzdem in den USA zunehmend populär geworden sind“. Er war auf einer Bush-Kundgebung, wo die Erklärung des Präsidenten, gegen Abtreibung zu sein, „einen der stärksten Aufschreie des Abends erhielt“.
Johnson zeigte das Ausmaß seiner Entfremdung von dieser Religiosität, als er darüber scherzte, sich bei einer Fahrt „durch das ländliche Virginia“ zu verfahren. Er dachte, er käme immer wieder an demselben Hügel mit drei Kreuzen darauf vorbei, bis er merkte, „dass die Kreuze in Wirklichkeit überall waren“. Und natürlich trank Bush kein Alkohol und ging jeden Abend um 21 Uhr ins Bett. Doch während die christlichen Aspekte der US-Kulturkriege in Großbritannien vielleicht nicht so richtig funktionieren, war es der weiße Nationalismus, für den die Republikaner eintraten, sicherlich wert, nach Hause gebracht zu werden.
Eine Sache, die Johnson an den USA wirklich beeindruckte, war „die Art, wie die Amerikaner ihre Flagge hissen“. Die Stars and Stripes waren überall zu sehen, „unverschämt, überschwänglich und stolz“. Und in den Schulen „beginnen amerikanische Kinder ihren Schultag immer noch mit dem Treueschwur auf die Flagge“.
Der Kontrast zur britischen Einstellung zur Union Flag war beschämend. Mehr noch, er fing er an zu argumentieren, dass „wir keine wirklichen Loyalitätsanforderungen mehr an diejenigen stellen, die Migrant*innen oder Kinder von Migrant*innen sind“.
Und das war offenbar der Grund, warum die USA ihre Selbstmordattentäter importieren mussten, „während wir unsere eigenen produzieren“. Er fährt fort: „Zu viele Briten haben absolut kein Gefühl der Zugehörigkeit zu diesem Land (…) Dies ist eine kulturelle Katastrophe, die Jahrzehnte brauchen wird, um sie rückgängig zu machen“. Er kündigte an, dass The Spectator eine Kampagne für „die Re-Britannifizierung Großbritanniens“ starten würde. Dies schrieb er im Mai 2005: Die sogenannten Kulturkriege hatten begonnen.
Es ist wichtig, sich hier an ein Schlüsselelement der US-Kulturkriege zu erinnern: Die Rechte behauptete immer, das Opfer zu sein, das sich gegen einen unterdrückenden Aggressor wehrt. In den USA waren die Aggressoren die Liberalen und Säkularen, in Johnsons Großbritannien waren die Aggressoren die „Linken“.
Da es in Wirtschaftsfragen so viele Gemeinsamkeiten zwischen den Tories und Blairs Labour gab, konzentrierte sich Johnsons Spectator auf Labour als Partei der Regulierung, der Einmischung der Regierung und der Sozialhilfeabhängigkeit. Dies demoralisiere immer noch die Menschen der Arbeiter*innenklasse, bremse ihren Unternehmergeist und hindere sie daran, auf eigenen Füßen zu stehen.
Nachdem er mit dem Triumph des Thatcherismus das ökonomische Argument verloren hatte, argumentierte Johnson, dass die Linke keineswegs verschwunden, sondern mutiert sei. Es bestehe „keine Notwendigkeit mehr, große Teile der Industrie zu besitzen“. Stattdessen könne die Linke „ihre Ziele durch Regulierung und die Tyrannei der politischen Korrektheit erreichen“. „Linke sind grundsätzlich an Zwang und Kontrolle interessiert, und überall in der britischen Gesellschaft kann man sehen, welche großen Fortschritte sie bei der Erreichung ihrer Ziele machen“, schrieb er. „In den Aushöhlungen der Redefreiheit und der bürgerlichen Freiheiten, die unter dieser Regierung stattfinden, in der immer aufwändigeren Regulierung des Arbeitsplatzes, den Verboten von Jagen, Schmatzen, Rauchen und so weiter.“
Das schrieb er im Februar 2006. Es ist bemerkenswert, dass Johnson zu dieser Zeit den Mindestlohn als schockierende Verletzung der britischen Freiheit und die Einführung von Gebühren für den staatlichen Gesundheitsdienst, den National Health Service (NHS), als „schöne neue Welt“ betrachtete.
Johnson war bereits stark in den kulturellen Auseinandersetzungen engagiert. Zur Erinnerung: Das war zu einer Zeit, als Blair und Brown Großbritannien zum Nutzen des Großkapitals regierten und beide Rupert Murdoch hofierten.
Eine der Schlüsselfronten, die Johnson für den Kampf im sogenannten Kulturkrieg auswählte, war das Verbot der Fuchsjagd. Er war außer sich vor Wut über diesen Angriff der Labour-Partei auf die britische Freiheit und Tradition und schwor den Verantwortlichen unendliche Feindschaft. Es sei eine marxistisch inspirierte Gräueltat. All dieser Lärm und Zorn bedeuteten natürlich nichts. Die Fuchsjagd, eines der großen Anliegen von Boris Johnson, das ihm offenbar am Herzen liegt, bleibt auch während seiner Regierungszeit verboten.
Interessanter ist seine Reaktion auf Bushs Ablehnung des Kyoto-Protokolls, das die Unterzeichnerstaaten zur Reduzierung der Treibhausgasemissionen verpflichtet. Er schwärmte förmlich von Bush. Es war „großartig, wie er es mit den großen transatlantischen Linksliberalen aufgenommen hat“. Es sei ein wunderbares Beispiel für einen „überschwänglichen Reaganismus“. Und die Behauptung, Bush habe „zukünftige Generationen einem staubigen Planeten“ überlassen, sei so was von Unsinn, denn die Zeit werde kommen, „wenn der Markt und unweigerlich die US-Technologie einen grüneren Planeten liefern werden“.
Wir können absolut sicher sein, dass er das immer noch glaubt. Jeder, der ernsthaft glaubt, dass Johnson den Kampf gegen die Klimakatastrophe jemals über das Streben nach Profit stellen würde, muss die Vergangenheit dieses Mannes betrachten.
Was ist mit Johnson und Rassismus? Natürlich ist er für seinen beiläufigen Rassismus bekannt, für seine rassistischen Bemerkungen. Aber es ist mehr als das. Johnson hat eine ausgeklügelte Strategie, um seinen Rassismus nach außen zu tragen und gleichzeitig seinen Rücken zu decken.
Was er tut, ist, Bemerkungen, die alle seine rassistischen Bewunderer als rassistisch erkennen, mit einer gleichzeitigen Verurteilung von Rassismus zu verknüpfen. Als er die Kampagne zur „Re-Britannisierung Großbritanniens“ startete – eine Kampagne, die mit Islamophobie gespickt war –, positionierte er sich gegen Enoch Powell, der rassistische Argumente in Debatten über Migration einbrachte.
Bei einer anderen Gelegenheit, im April 2002, veröffentlichte er ein Interview mit dem Chef des französischen faschistischen Front National, Jean-Marie Le Pen. Er verteidigte diese Entscheidung, indem er den damaligen Innenminister der Labour-Partei, David Blunkett, angriff. Le Pen hätte bei den Wahlen gut abgeschnitten, weil die französischen Wähler*innen, wie „die britische Wählerschaft (…) etwas gegen die Kriminalität und das, was sie als unkontrollierbares Verhalten der illegalen Einwanderer*innen ansahen, unternehmen wollten“.
Und dies ist nur ein Beispiel für Johnsons Taktik. Ein weiteres aktuelles Beispiel kam im August 2018. Er sprach sich gegen das Burka-Verbot der dänischen Regierung aus und beschrieb dann die Frauen, die sie trugen, als „Bankräuber“ oder „Briefkästen“.
Schlimmer noch: Johnson veröffentlichte regelmäßig eine Kolumne von Taki Theodoracopulos – einem Sympathisanten der griechischen Nazi-Partei Goldene Morgenröte. Darunter befand sich eine, in der er behauptete, dass Schwarze einen niedrigeren IQ als Weiße hätten, und eine andere, die sogar der Eigentümer des Spectator, Conrad Black, als antisemitisch beanstandete. Theodoracopulos gründete daraufhin sein eigenes Online-Magazin in den USA, das Teil der politischen Konstellation der Alt-Right ist. Tatsächlich wurde der Begriff „alt right“ zum ersten Mal in diesem von einem der damaligen Herausgeber, dem antisemitischen weißen Nationalisten Richard Spencer, verwendet. Und die faschistischen Proud Boys wurden 2016 auf den Seiten des Magazins gegründet.
Johnson, das müssen wir anerkennen, hat absolut kein Problem damit, von der extremen Rechten unterstützt zu werden. Das ist etwas, das er mit Donald Trump teilt. In der Tat traf sich Johnson auf seinem Weg zur Spitze der konservativen Partei sowohl mit Steve Bannon als auch mit dem weniger bekannten Stephen Miller. Miller war der Architekt von Trumps bösartiger Anti-Einwanderungspolitik, sein Redenschreiber und der Anheizer bei seinen Kundgebungen. Johnson war offenbar stark auf Miller fixiert und traf ihn in seiner Zeit als Außenminister bei mehreren Gelegenheiten heimlich außerhalb des Weißen Hauses.
Es ist immer noch gewöhnungsbedürftig, dass dieser lügende, schimpfende, völlig unverantwortliche, gierige, tyrannische, selbstherrliche Trottel Premierminister ist. Aber wie wir bereits gesehen haben, ist er nicht dazu da, das Land zu regieren, sondern um denen Deckung zu geben, die es tatsächlich tun.
Jede Woche sehen wir ihn unterwegs. Er wird dabei gefilmt, wie er einen Ziegelstein legt, einen Pappkarton aufhebt, sich eine Maschine ansieht oder im Fahrerhaus eines Lastwagens sitzt. Ein anderes Mal nimmt er ein Reagenzglas in die Hand, wischt einen Stuhl ab oder nimmt an einer Grundschulstunde teil und zeigt bei jeder Gelegenheit den Daumen nach oben. Das ist sein Job.
Er ist die Maske, hinter der die Tory-Rechte ihrer Arbeit nachgeht, die Förderung und Konsolidierung eines Niedriglohn- und Hochprofit-Britanniens. Großbritannien wird immer noch zum Nutzen der globalen Superreichen umgestaltet. Und den sogenannten Kulturkampf zu führen, ist heute wichtiger als je zuvor. War es früher nur der Spectator, so ist heute die gesamte rechte Presse offenbar davon besessen, dass die „Woken“ alles „canceln“, was ihnen lieb und teuer ist. Sie haben es auf jede Institution abgesehen, die es auch nur wagt, sich mit der blutigen Geschichte von Sklaverei und Kolonialismus auseinanderzusetzen.
Ihre Hoffnung ist, dass die Kulturkriege genutzt werden können, um eine soziale Unterstützerbasis zu konstruieren, die loyal bleibt, egal wie katastrophal und korrupt die Tory-Politik auch ist. Sie hoffen, dass die Rettung der Statuen von mordenden Sklavenhändlern für die Menschen wichtiger sein wird als die Privatisierung der staatlichen Gesundheitsversorgung, die grausame Einwanderungspolitik oder der Abbau der bürgerlichen Freiheiten.
Sie schauen immer noch auf die US-Republikaner und Donald Trump als Inspiration. Es gibt ein klares Element der Verzweiflung in all dem, und vieles davon ist geradezu lächerlich. Offensichtlich ist der Großteil der Presse bereits auf ihrer Seite, aber wir müssen uns auf eine große Kampagne einstellen, um Schulen und Universitäten in den Kampf einzubeziehen. Hier können wir sie schlagen.
Der Versuch, das FOX-Modell des Journalismus als offene rechte Propaganda zu importieren, ist bei GB News ins Stocken geraten. Doch wir dürfen nicht selbstgefällig sein. Die Rechte hat in den USA jahrzehntelang Identitätspolitik betrieben. Um nicht in der gleichen Position zu enden, müssen wir kompromisslos Großbritanniens anhaltende Geschichte von Rassismus, Imperialismus, Sexismus, Homophobie und Klassenkampf gegen die Arbeiter*innenklasse aufdecken.
Der Artikel von John Newsinger erschien bei der Socialist Workers Party und wurde von Lukas Geisler übersetzt.